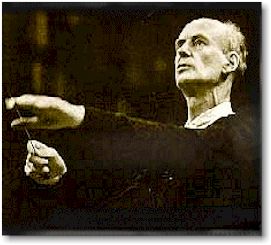 Wilhelm Furtwängler |
Wilhelm Furtwängler und sein Buch "Gespräche über Musik" |
|
|
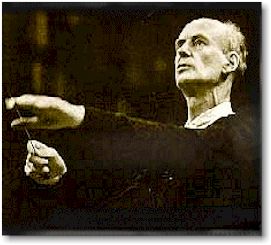 Wilhelm Furtwängler |
Wilhelm Furtwängler und sein Buch "Gespräche über Musik" |
|
Einleitung Wie am Ende von Teil 2 der Serie "Musiker über Musik und Beethoven" angekündigt, wollen wir Ihnen hier einen kurzen Eindruck des deutschen Dirigenten Wilhelm Furtwängler und seines Wirkens vermitteln. Nach einer kurzen biographischen Schilderung und nach Yehudi Menuhins Kommentar zu seinem Eintreten für Furtwängler in den Nachkriegsjahren soll der Dirigent jedoch am besten unmittelbar selbst zu Wort kommen. Dazu bieten sich uns zwei Quellen an: Karla Höckers Büchlein "Sinfonische Reise" aus dem Jahre 1955, aus dem wir nur Furtwänglers unmittelbaren Kommentar zu Beethoven entnehmen, und sein eigenes Buch "Gespräche über Musik" aus den Jahren 1936/1937 und 1947, in dem er in sechs Gesprächen einige Fragen Walther Abendroths zur Musik zu beantworten versuchte. Beide Male nimmt Furtwängler sehr ausführlich zum Thema Beethoven Stellung. Biographische Kurzbeschreibung aus "Norton/Grove's Concise Encyclopedia of Music": Furtwängler, (Gustav Heinrich Ernst Martin) Wilhelm (geboren am 25. Januar 1886 in Berlin, gestorben am 30, November 1954 in Baden-Baden). Was in diesem Lexikon nicht erwähnt ist, ist die Tatsache, daß er als Sohn eines bekannten deutschen Archäologen sowohl in Berlin als auch in München eine sehr gründliche klassische Schulbildung erhielt und auch seinen Vater auf Reisen begleitete, so daß er die Musik zunächst wohl nicht als seine einzig mögliche Laufbahn, jedoch als die Krönung seiner Wünsche und Ambitionen betrachten konnte. Nun setzt auch "Norton/Grove" damit ein zu erwähnen, daß Furtwängler als Musiker sich ursprünglich auf das Komponieren konzentrieren wollte, daß er aber schon 1907 in München sein erstes Konzert dirigierte, und ihn danach seine Laufbahn als Dirigent nach Breslau, Zürich, München und Straßburg führte. Bereits von 1911 an war er in leitenden Positionen zu finden, nämlich von 1911 - 1915 als Operndirektor in Lübeck und von 1915- 1920 in Mannheim. Dies zementierte seinen Ruf als führenden jungen deutschen Dirigenten, als der er in den Jahren zwischen 1920 bis 1928 in Berlin und Frankfurt Orchester dirigierte. Von 1928 hatte er die Leitung des Leipziger Gewandhausorchesters und der Berliner Philharmoniker inne. Von 1924 an war er auch regelmäßig in London zu Gast, wo er in den 30er Jahren den "Tristan" und den "Ring" dirigierte, und in den USA von 1925 an. Obwohl er auch die Wiener Philharmoniker öfters dirigierte, war er doch am engsten mit den Berliner Philharmonikern verbunden, mit denen er in ganz Europa gastierte. Als Mitglied der bürgerlichen Klasse und aus persönlichen Gründen war es ihm nicht möglich, das Hitlerregime zu unterstützen, aber er konnte sich auch nicht von seiner Identität als Deutscher lösen und verbrachte die Jahre 1933 - 1945 in einer ambivalenten Haltung zum Regime des 3. Reiches in Deutschland. So hatte er zum Beispiel noch im Jahre 1934 Hindemit's Oper "Mathis der Maler" aufgeführt, die von Goebbels denunziert wurde. Er legte in diesem Jahre seine offiziellen Ämter nieder, arbeitete aber von 1935 weiterhin mit den Berliner Philharmonikern in Berlin. Nach dem Krieg mußte er sich erst einigen Verfahren zur Klärung seiner Rolle im 3. Reich unterziehen und konnte daher erst ab 1946/1947 wieder tätig sein. Während Yehudi Menuhin bereits im Jahre 1946 in Berlin mit den Philharmonikern auftrat, geschah dies 1946 noch unter Sergiu Celibidache und erst 1947 unter Furtwängler. Danach stand Furtwänglers internationalen Auftritten mit seinem Orchester in Mailand, Salzburg, London und weiten Teilen Europas sowie auch wieder 'zuhause' in Berlin nichts mehr im Wege, obwohl er nicht mehr in den USA auftrat. Norton/Grove beschreibt Furtwänglers Kunst und seine Fähigkeit, jede Vorstellung in eine spontane Wiederauferstehung des Werks des/der Komponisten zu verwandeln sowie seinen absichtlich nicht zu genau eingehaltenen Takt, durch den er eine vollen, ungezwungenen Orchesterklang und ein fluktuierendes Tempo erzielte, das durch seine Meisterschaft eine einzigartige künstlerische Intuition und Einsicht widerspiegelte. Sein Repertoire bestand hauptsächlich aus den großen deutschen Klassikern, aber er hat auch viele Werke von Tschaikowsky, Berlioz und Debussy dirigiert und sogar die Uraufführung von Bela Bartoks Erstem Klavierkonzert und Schoenbergs Orchestervariationen. Seine eigenen Kompositionen schließen drei Symphonien, einige Vertonungen von Goetheschen Texten für Chormusik, sowie Kammermusik und Klaviermusik ein. Bevor wir hier nun Furtwängler direkt zu Wort kommen lassen, möchten wir Sie doch auch in Yehudi Menuhins eigenen Worten aus seinem Buch Unvollendete Reise zu seinem Eintreten für Furtwängler nach dem 2. Weltkrieg vertraut machen: "Dennoch habe ich mich nie gescheut, in Wespennester hineinzustechen. Warum wohl? frage ich mich selbst. Um wie ein freundlicher Narr in schwierige Situationen hineinzustolpern, über deren Lösung selbst die klügsten Köpfe atemlos brüten? Um die Rolle des selbstgerechten Pedanten zu spielen, der glaubt, daß alle anderen auf dem falschen Weg sind? Oder die Stellung des Märtyrers einzunehmen, der genau weiß, daß er kein Monopol auf Wahrheit besitzt und dennoch seine Überzeugung gegen die übliche Meinung ins Feld führt? Natürlich hoffe ich, daß sich genug Beweise werden anführen lassen, wie sehr ich dieser letzten Interpretation zuneige. Die erste Polemik, die ich bewirkte, ist im Laufe der Jahre, glaube ich, für mich positiv ausgegangen (es sei denn, daß auch hier die Zeit nur die bösesten Wunden hat heilen lassen). Das war, als ich nach dem Zweiten Weltkrieg für Wilhelm Furtwängler eintrat, Furtwängler war ein Dirigent, den ich - obwohl nur aus der Entfernung - hoch achtete. Bis 1947 hatte ich nie mit ihm gespielt, aber aus Berichten und von Schallplatten her wußte ich, daß es ein außergewöhnliches Erlebnis sein müßte, unter ihm zu musizieren. Das stellte sich auch sehr bald heraus. Obwohl er sich von Bruno Walter durchaus unterschied, nahm Furtwängler, indem er die deutsche Tradition zu einem Höhepunkt führte, in meinem privaten Pantheon die Stellung als Walters Nachfolger ein. Ich war ihm jedoch noch nie begegnet. Nach einem ersten Besuch im befreiten Europa war ich nach New York zurückgekehrt und wurde dort wie ein irisch eingetroffener Zeuge vom Schlachtfeld des Sieges auf einer Pressekonferenz ausgefragt, ob man nicht der Kultur in Deutschland nach Hitler mit Mißtrauen begegnen müsse. Ich sah keinen Sinn darin, die Wunden für alle Zukunft offenzuhalten, und glaubte mich verpflichtet, auch über gute Dinge zu berichten, wenn sie zutrafen; so gab ich das Urteil weiter, das ich in Paris gehört hatte: Französische Musiker hatten mir erzählt, berichtete ich, daß von allen ihren in Deutschland gebliebenen Kollegen Wilhelm Furtwängler derjenige gewesen sei, dem sie das herzlichste Willkommen bereiten würden; nicht etwa nur wegen seiner hervorragenden musikalischen Fähigkeiten, sondern weil er sich zum Beispiel geweigert hätte, die Berliner Philharmoniker auf ihren Propagandatourneen durch das besetzte Frankreich zu dirigieren. So weit, so gut. Allerdings konnte ich nicht voraussehen, daß diese spontan geäußerte Information flugs zu einer Waffe in einem Kampf geschmiedet werden würde, von dem ich gar nicht wußte, daß ich ihn kämpfte. Am folgenden Tag verkündeten die Schlagzeilen der Zeitungen, ich wolle Furtwängler nach Amerika holen. Es gab einen Aufschrei unter den Juden in Amerika. Furtwänglers Fehler, und vielleicht auch meiner, lag darin, die Macht der Musik etwas zu überschätzen. Wenn er auch nicht erwartete, daß sie uns von den Sünden freisprechen könne, glaubte er doch daran, daß sie Vergiftungen werde heilen helfen. Noch kurz nach dem Reichstagsbrand 1933 hatte Furtwängler Artur Schnabel, Bronislaw Huberman und mich eingeladen, als Solisten in der Berliner Philharmonie aufzutreten. Wir alle sagten ab. Als Direktor der Berliner Staatsoper entschloß er sich 1934, Hindemiths Oper Mathis der Maler herauszubringen, obwohl er wußte, daß dieser »dekadente« Komponist offiziell gar nicht existierte; als Göring die Vorstellung unterband, reichte er seinen Rücktritt ein. Man mag der Meinung sein, daß die folgenden Schläge, die er einstecken mußte, ihn hätten überzeugen müssen, daß der Mittelweg, den er einzuhalten versuchte, nur ein Niemandsland war, ein veralteter Ehrenplatz des neunzehnten Jahrhunderts, der kaum länger zu verteidigen war. Falls ihn dies tatsächlich überzeugte, dann entschloß er sich zur Rolle des lebenden Selbstmörders. Sein Prestige reichte nämlich nur so weit aus, in diesem Dschungel weiterhin den Aristokraten zu spielen, sich durch humane Hilfeleistungen »strafbar« zu machen, vergebliche Proteste zu erheben und ungehindert den Fehdehandschuh hinzuwerfen : Niemals kam es so weit, daß er von sich aus endgültig den Hut nahm oder aber ins Konzentrationslager gesteckt würde. Richard Wagners Enkelin Friedelind, die 1939 aus Nazideutschland emigrierte, hat von einem Treffen zwischen Hitler und Furtwängler im Bayreuther Haus ihrer Mutter 1936 berichtet. »Ich erinnere mich, daß Hitler sich Furtwängler zuwandte und ihm mitteilte, er müsse es sich gefallenlassen, von der Partei zu Propagandazwecken eingesetzt zu werden, und ich weiß genau, daß Furtwängler ablehnte. Hitler wurde ganz ärgerlich und ließ Furtwängler wissen, in diesem Falle wäre ihm ein Platz in einem Konzentrationslager sicher. Furtwängler hielt einen Augenblick inne und sagte dann: >Herr Reichskanzler, dann werde ich in guter Gesellschaft sein.< Offensichtlich war Hitler von dieser Abfuhr so überrascht, daß er nicht eine seiner langen Tiraden begann, sondern einfach wegging.« Im selben Jahr hatte Furtwängler jedoch ein Angebot abgelehnt, als Toscaninis Nachfolger ständiger Dirigent der Philharmoniker in New York zu werden, und zwar auf Grund einer jüdischen Intervention, derzufolge er in New York nicht dirigieren könne, »bevor die Öffentlichkeit bereit ist, zuzugeben, daß Politik und Musik verschiedene Dinge sind«. Weder Hitler noch die Juden konnten sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen, so daß Furtwängler sich im Abseits befand: ein Fremder im nationalsozialistischen Deutschland und ein Nazi in den Augen der Fremden. Ich wünschte, es wäre mir bei jenem Abendessen in Mailand 1946, als Toscanini nacheinander alle seine Dirigentenkollegen auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen beliebte, der Gedanke gekommen, ihn nach seiner Meinung über Furtwängler zu befragen (aber ich vermute, ich war einfach zu feige). Damals war Furtwängler kein Unbekannter mehr, aber eine schwer einschätzbare Größe für mich, wenn ich auch wußte, daß dies eine Kardinalfrage gewesen wäre. Denn sie beide waren große Rivalen, die in einer Atmosphäre hitziger Parteinahme musikalische und menschliche Ziele verkörperten, die einander fast ausschlossen; sie waren wie zwei Gladiatoren, die in derselben Arena vor ihren eigenen Mannen gegeneinander antreten und den Sieg für sich reklamieren. Beide hatten in Wien dirigiert, beide bei den Bayreuther Festspielen, und kaum hatte der eine den andern übertrumpft, als es sofort neue Parteinahmen gab. Ich glaube, Toscanini war zumindest teilweise dafür verantwortlich, daß New York sich gegen Furtwängler sträubte. Nicht nur ihre verschiedene Nationalität, nicht nur ihr entgegengesetztes Temperament trennte sie, sondern auch Herkunft und Erziehung: Toscanini, das Kind armer Bauersleute, dessen Hoffnung auf eine musikalische Karriere sich schon im Orchestergraben der Oper zu erfüllen begann ; daneben Furtwängler, der Sohn eines Archäologie-Professors, der seine Kindheit mit klassischen Studien und bei Ausgrabungen verbrachte - jemand, für den Musik nicht eine erste und einzige Tätigkeit bedeutete, sondern Krönung des Lebens. Furtwängler war höchst eigenwillig, sowohl durch natürliche Anlage wie durch gesellschaftliche Herkunft, und es ist möglich, daß er darum innerlich etwas weniger gut gewappnet war als der Selfmade-man Toscanini. So scheute er jede Kritik: Ob er sich, hochmütig, darüber erhaben fühlte oder eine Unsicherheit verbarg, die nur durch Bewunderung aufgehoben werden konnte, vermag ich nicht zu sagen. im Gegensatz dazu war Toscanini - dessen hervorragende Stellung in New York ihn, von gelegentlichen feindlichen Äußerungen abgesehen, genereller Kritik entrückte - sich seiner Stellung als Priester der Musik viel zu sicher, um nicht jedermann zu verachten, der so irregeleitet war, anderer Meinung zu sein als er. All diese Gegensätze des Charakters, der Lebensumstände und der Empfindungswelt prägten, ja überschatteten ihr jeweiliges Verhältnis zur Musik. Einmal, in Luzern, verglich Furtwängler die Musik mit dem Fließen eines Stromes : ihm müsse der Dirigent folgen, dabei auch die Topographie beachten, ob die Flut durch enge Stromschnellen jage oder in die ruhige Ebene hinausführe. Er hielt nichts von Methode, von metronomischer Strenge, jenen Maßen und Gewichten musikalischen Krämertums; er verließ sich auf seine Intuition, die ihn traumwandlerisch durch die Partituren leitete. Glücklicherweise führte ihn diese Intuition nicht auf Abwege : sie wurde von der Musik geformt, die sie ihrerseits formte. Furtwängler war schließlich alt genug, um Brahms noch gekannt zu haben. Wie seine Plattenaufnahmen zeigen, dirigierte er dasselbe Stück niemals gleich: jedesmal unterwarf er sich dem Strom, der sich ja inzwischen verändert haben mochte - vielleicht war es Frühling, und der Fluß floß von geschmolzenem Schnee über, vielleicht hatte es einen trockenen Sommer gegeben oder einen plötzlichen Gewittersturm mit Wolkenbruch. Carl Flesch hat diese Art des Suchens folgendermaßen beschrieben: »Furtwängler musiziert aus einer gewissermaßen sublimierten Sinnlichkeit heraus, nach dem Ausspruch des Ekklesiasten: >Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich eine klingende Schelle.< In seinem Musizieren gibt es keinen toten Punkt. Alles lebt, liebt, leidet und jubelt... Diese Jagd nach dem unmittelbaren klanglichen Genuß, diese don-juaneske Ruhelosigkeit der Empfindung, diese Sucht nach steter Erneuerung des Fühlens bewirken, daß sein Musizieren den Zuhörer eher erregt als bewegt...« »Furtwängler«, schließt Carl Flesch, »hat mir unter allen Dirigenten am nächsten gestanden. Ein wohltuender Mangel an selbstherrlichem Größenwahn, dem Charakteristikum seiner Kaste, Bescheidenheit, die sich zuweilen selbst in innerer Unsicherheit äußerte, und vor allem etwas Naiv-Kindliches, das stets den echten Künstler auszeichnet.« Diese Fähigkeit, durch Abstraktion zu einer Art Ekstase zu gelangen, war nicht sein Privileg, sondern in der deutschen Kultur nicht unbekannt: degradiert und deformiert gebar sie den grotesken Mythos des Nationalsozialismus; wenn man sie in der reinen Luft zweckfreier Wahrheitsliebe sich entwickeln ließ, entsprang daraus Philosophie, Musik von Beethovenscher Universalität und musikalische Interpretation von hohem Rang. Heute verkörpert zum Beispiel Wilhelm Kempff diese Tradition. Toscaninis Größe lag woanders. Für den Deutschen mag ein Ding zum Symbol werden, welches das Universum umgreift; für Toscanini blieb das Ding ein Ding, eine Komposition war kein sich schlängelnder Flußlauf, sondern eine Römerstraße, keine unvorhersehbare Naturkraft, kein Mystizismus, dem er sich unterwerfen mußte, sondern Ausdruck menschlichen Geistes, den lateinische Klarheit zu durchdringen und zu erleuchten vermochte. Während in unseren Tagen Wilhelm Kempff, wohin er auch kommt, deutsche Tradition überall entdecken kann, fühlte sich Furtwängler tief in seiner Vergangenheit verwurzelt, und er mag geglaubt haben, daß die Verpflanzung in ein anderes Land seine Identität gefährden würde und daß es tatsächlich eine ethnische oder gar nationale Seele gebe, deren »Melos« zu einem Land gehört wie seine Hügel und Ebenen, und daß seine musikalische Vorstellung am ehesten in Deutschland, von einem deutschen Orchester gespielt, vor einem deutschen Publikum zu verwirklichen sei. Während Toscaninis metronomischer Puls transportabel und überall anwendbar war, verlangte Furtwänglers ständiges vibrieren, sein unvergleichliches nervöses Verwischen der Linien sowie seine Forderung nach »Fließen« tatsächlich eine fast telepathische Vertrautheit mit dem Orchester. Von diesem »Geheimnis« sagte er, es liege in der »Vorbereitung des Schlags, nicht im Schlag selbst - in der kurzen, oft winzigen Bewegung des Niederschlags, bevor der Zusammenklang des gesamten Orchesters erreicht ist. Die Art und Weise, in der dieser Niederschlag, die Vorbereitung dazu, ausgeführt werden, bestimmt die Klangqualität mit absoluter Genauigkeit. Selbst der erfahrenste Dirigent ist immer wieder erstaunt von der unglaublichen Genauigkeit, mit der ein gut eingespieltes Orchester auf seine winzigsten Gesten reagiert.« Diese seine »winzigsten Gesten« waren oft nur um weniges winziger als die übrigen. Furtwänglers Scheu vor präzisen Einsätzen, vor Akzenten, vor Anfängen und Schlußakkorden war so groß, daß es ihn schiere Angst kostete, den Taktstock herunterzuschlagen; wenn man einem Musiker, der oft unter ihm spielte, Glauben schenken soll, tat er es, nachdem der Taktstock »dreizehnmal vorher gezittert« hatte. Derartige Skrupel öffnen zwar den Weg zur Musik, lassen einen jedoch schutzlos angesichts des moralischen Dilemmas, das ein Tyrann uns allen aufzwingt. Und weil er ein so großer Künstler war, zog er den Haß auf sich. Ich glaube, nicht völlig zu unrecht: denn wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Furtwängler wurde auf höchst unfaire Weise zu einem Zeitpunkt angegriffen, als es in der Welt üblich war, sich zu empören. Sehr viel kompromißbereitere Musiker als er, die sich mit Hilfe der Parteizugehörigkeit und durch ihre Haltung den Nazis gegenüber ihre Karrieren ebneten, sind inzwischen längst wieder wohlgelitten und geachtet, und kein Makel ist ihnen zurückgeblieben. Furtwängler jedoch stand sichtbar in aller Öffentlichkeit, Zielscheibe jeder Verleumdung. In seinem Fall vermochte er jeden Verdacht leicht zu entkräften. Ohne ihn wäre es Carl Flesch gewiß nicht gelungen, aus dem besetzten Holland in die Schweiz zu fliehen; eine Reihe jüdischer Musiker, die gesund und glücklich in Amerika saßen, bezeugten seine Bemühungen, sie vor Deportation zu bewahren. Aber er hatte im NS-Staat ein offizielles Amt innegehabt, und bevor man ihn von den Vorwürfen freisprach, durfte er keinen neuen Posten annehmen. Auf Einladung der amerikanischen Militärregierung spielte ich 1946 und 1947 in Berlin. Ich wollte unbedingt dorthin, sowohl als Jude, der bei den Deutschen ein Gefühl von Schuld und Reue wachhielt, wie als Musiker, der etwas mitbrachte, für das zu leben sich lohnte. Beim ersten Mal war Furtwängler noch suspendiert, und das Orchester spielte unter Sergiu Celibidache, aber 1947 war Furtwängler zurückgekehrt" (Menuhin über Furtwängler [S. 251-256]). Dieser sehr persönliche und menschliche Kommentar Yehudi Menuhins bot uns Gelegenheit, Furtwänglers Problematik von einem ihm wohlgesonnenen, inernational anerkannten Kollegen nähergebracht zu erhalten und stimmt uns vielleicht zugleich auch auf seine eigenen direkten Kommentare ein. Seine erste Äußerung zu Beethoven entnahmen wir einem kleinen Büchlein, das in seiner Schreibweise dem heutigen Standard im allgemeinen wohl nicht mehr standhalten würde, nämlich Karla Höckers "Sinfonische Reise" aus dem Jahre 1955. (Diese ehemalige Bratschistin und spätere Musikschriftstellerin begleitete Furtwängler in den frühen 50er Jahren auf einer Konzerttour mit den Berliner Philharmonikern.) Furtwänglers Beethovenkommentar daraus ist jedoch immer noch Furtwängler selbst zu Beethoven: "Im Laufe des 19. Jahrhunderts war Beethoven der unbestrittene König der europäischen Musik geworden. Heute mögen wir vielleicht nicht mehr geneigt sein, solch ein Herrschertum anzuerkennen. Trotzdem oder gerade deshalb ist es wohl der Mühe wert, sich die Frage vorzulegen, worauf die immer noch bestehende Ausnahmestellung Beethovens eigentlich beruht, warum er von einer Atmosphäre einsamer Großartigkeit umwittert ist, die ihn hinaushebt über andere, an sich nicht weniger erlauchte Namen! Was bei Beethoven vor allem ins Auge fällt und in seinen Werken stärker zur Auswirkung kommt als in denen anderer Meister, ist das, was ich das Gesetz nennen möchte. Er erstrebt wie keiner sonst das Natürlich-Gesetzmäßige, das Endgültige; daher die außerordentliche Klarheit, die seine Musik kennzeichnet. Diejenige Art von Einfachheit, die in ihr waltet, ist nicht die Einfachheit der Naivität, ist nicht Primitivität, sie ist auch nicht eine auf den Effekt berechnete Sinnfälligkeit. Und dennoch ist niemals eine Musik geschrieben worden, die so direkt, so offen, gleichsam nackt dem Hörer entgegentritt! Aus Beethovens Leben wissen wir, daß er durchaus kein leicht arbeitender Künstler war, daß die Monumentalität und Einfachheit seiner Thematik ihm keineswegs in den Schoß fielen. Im Gegenteil: jedes seiner Werke stellt den konzentrierten Extrakt einer ganzen Welt dar, ist aus einem grenzenlos chaotischen Leben und Erleben erst zur Ordnung, Form und Klarheit durch den eisernen Willen des Künstlers hingeführt worden. Diese besondere Art von Klarheit bedeutet indessen den Verzicht auf alle jene Mittel, die es in der Kunst ebenso gibt wie im Leben, das Gesagte in vorteilhafte Beleuchtung zu rücken, es durch die Art der Färbung, der Pointierung tiefer und größer erscheinen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist." (In unserem Jahrhundert, schaltet Furtwängler hier ein, gäbe es nicht wenige Komponisten, die insofern das gerade Gegenteil zu Beethoven darstellten, als ihnen eine außerordentliche Fähigkeit zur Verschleierung, um nicht zu sagen: zur Vernebelung ihrer Gedanken eigen sei: was meist nur von den ganz Naiven - zu denen seltsamerweise auch viele Großstadtintellektuelle gehörten - nicht als das erkannt würde, was es in Wahrheit sei.) Nach dieser Abschweifung fährt er fort: "Beethoven begreift sich in die ganze, runde, komplexe Menschennatur. Es ist wahrhaft umfassend. Er ist nicht vorwiegend kantabel wie Mozart, nicht vorwiegend architektonisch-schwingend wie Bach, nicht dramatisch-sensuell wie Wagner. Er ist - und darin berührt seine Eigenart - alles dieses gleichzeitig und jedes an seinem besonderen Platz. Dies aber ist, wenn man es richtig betrachtet, etwas höchst Merkwürdiges! Es gibt nämlich innerhalb der gesamten europäischen Entwicklung keine Musik, bei der die verschiedenen Elemente des Gesangvollen und des rein Strukturellen, bei der das Weiche und das Harte, die erst in ihrem Zusammenwirken den lebendigen, natürlichen Organismus ausmachen, eine so naturverbundene Synthese eingegangen sind. Bei aller Gewalt, die diese Musik durchweht, ist es wie eine heilige Nüchternheit, die sie in das Gesetz alles Organischen zwingt. Sie ist explosiv, ja ekstatisch bis zur Grenze menschlicher Erlebnismöglichkeit - und dennoch nicht im geringsten exaltiert. Ich glaube, daß es hauptsächlich diese Eigenschaften sind, die die eigentliche Weltgültigkeit Beethovenscher Musik ausmachen. Nie hat es eine weniger künstliche, eine selbstverständlichere, bei aller Gewalt des Ausdrucks schlichtere - oder, um es modern auszudrücken - sachlichere Musik gegeben als die seine. Heute, im Zeitalter der Sachlichkeit - wobei ich dieses Wort durchaus positiv meine -, ist er schon deshalb aktuell wie kein anderer! Welch wunderbarer Adel des Gefühls tritt uns überall dort entgegen, wo Beethoven am unmittelbarsten von sich selber auszusagen scheint. Die schönsten Beethovenschen Momente zeugen von einer Unschuld, einer kindlichen Reinheit, die trotz allem Menschlichen, das ihnen anhaftet, etwas wahrhaft Überirdisches hat. Niemals hat ein Musiker von der Harmonie der Sphären, dem Zusammenklang der Gottesnatur mehr gewußt und mehr erlebt als Beethoven. Daher fehlt ihm eines vollkommen: jede Sentimentlität und jedes Pathos - sofern man unter Sentimentalität und Pathos ein bewußtes, allzu bewußtes Sich-selber-Fühlen, Sich-selber-Ernstnehmen versteht. Wenn Beethoven Pathos hat, so das Pathos der Natur, weil es der unmittelbaren, elementaren Auswirkung der Kraft eigen ist. Er "zelebriert" nie, er will nie 'tief' erscheinen, er will überhaupt nicht erscheinen, er ist nur. Darin zeigt sich seine wahre Tiefe, seine echte Unschuld" (Höcker, Sinfonische Reise: 9 - 12). Unsere zweite Quelle direkter Furtwängler-Kommentare und Aussagen zu Beetoven ist sein eigenes Buch "Gespräche über Musik", das 1936-37 und 1947 entstand und in dem ihm Walther Abendroth einige Fragen zur Musik und zu seiner Arbeit stellte: Abendroth: Die Leitung des Philharmonischen Orchesters veröffentlichte kürzlich eine Liste der Werke, die vom Berliner Konzertpublikum besonders bevorzugt werden, die "Kasse machen". Dies läßt interessante Rückschlüsse auf die Psychologie des Publikums zu. Furtwängler dazu unter anderem: ... Was im übrigen die bekannten "Lieblinge" des Publikums betrifft - es sollen nach der Statistik des Philharmonischen Orchesters z.B. unter anderem die "ungeraden" Sinfonien von Beethoven … usw. … sein -, dürfte die Bevorzugung zum Teil praktische Gründe haben. Diese Werke zeichnen sich durch große Klarheit und Übersichtlichkeit der Linienführung aus. Durch eine Plastik der Erfindung, die auch durch unzulängliche und unklare Darstellung nicht ganz zu zerstören ist. Sie sind von der Qualität der Aufführung nicht so abhängig, sind nicht so leicht durch unfähige Interpreten zu verderben wie andere, weniger populäre, darum aber nicht weniger wertvolle Werke großer Meister. Abendroth: Wäre es nicht auch eine Aufgabe der Kritik, die Begriffe des Publikums über sich selbst, über seine eigenen Urteile zu klären? Furtwängler: Sie kann das nicht - wenn sie es auch möchte oder zu können glaubt. Denn sie selber ist zu sehr Teil des Publikums. Der Widerspruch, der darin liegt, daß die unmittelbare Reaktion des Publikums oftmals falsch, sein dauerndes Urteil aber doch richtig ist, hat nur den einen Grund, den ich schon erwähnte: daß es Zeit haben muß, sich mit einem Künstler und Kunstwerk auseinanderzusetzen. Und dies um so mehr, je gewichtiger und inkommensurabler jene sind. ...Was wäre z.B. - paradox gesagt - unser ganzes öffentliches Konzertleben, wenn Beethoven seine Sinfonien nicht geschrieben hätte? Beethovens Vorgänger und Nachfolger, vor allem aber er selbst, haben den Begriff "Konzertpublikum" durch ihre Werke recht eigentlich erst geschaffen. Freilich ist dieses Publikum dann etwas anderes als nur gestaltlose, willenlose Masse. Es besitzt eben durch den gestaltenden Künstler nun auf einmal Maßstäbe. Es stellt Ansprüche. Der Künstler muß diesen Ansprüchen standhalten. Aber auch der Künstler seinerseits hat wiederum Ansprüche an das Publikum, die denen des Publikums an ihn korrespondieren. Das Publikum erwartet solche Ansprüche von ihm, denn sie sind es, die ihm seine eigentliche Würde geben. Es ist eben ein Unterschied, ob eine Masse zu einer Einheit wird durch die Teilnahme an einem Pferderennen, einem Boxkampf, oder durch Anhören einer Beethovenschen Sinfonie. Auf die Art der Einigung kommt es an. Abendroth: ... Wollen Sie damit sagen, daß Publikums-Wirksamkeit eher ein Argument gegen ein Kunstwerk sei? Furtwängler: Keineswegs, das wäre ein allzu billiger und voreiliger Schluß, Beethovens Werke etwa deshalb abzulehnen, weil ihnen Publikums-Wirkung eignet, hieße, wirklich das Kind mit dem Bade ausschütten. Gerade bei einer Erscheinung wie Beethoven läßt sich am besten aufzeigen, was eine echte, sozusagen "rechtsgültige" Publikums-Wirkung ist. Seine Werke wirken nämlich durchaus und ausschließlich durch das, was sie sind: und nicht durch das, was sie darstellen; durch ihr Wesen - nicht durch ihre Fassade. Daß aber Beethoven so wirkt, wie er es tut, verdankt er der Klarheit, mit der er das, was er zu sagen hat, ausspricht. Größtmögliche Klarheit der Aussage ist denn auch die Art - ist die einzige Art -, wie der Künstler der Tatsache "Publikum" Rechnung tragen kann. Schon Goethe sagt: "Wenn mir einer etwas zu sagen hat, so muß er es deutlich und einfach sagen. Problematisches habe ich in mir selber genug." Freilich setzt das eines voraus: nämlich, daß man etwas zu sagen hat, d.h. es wagen kann, sich gleichsam nackt, ohne jede Hülle zu zeigen, wie man ist. Das ist nicht jedermanns Sache; und diejenigen, die sich kompliziert ausdrücken, auch unter Künstlern - und gerade unter ihnen -, mögen meistens ihre Gründe dafür haben. Es gibt Kunstwerke, die wirken, weil sie wirken wollen. Und es gibt wiederum solche, die wirken aus ihrem bloßen Sein heraus. Hier liegt die Ursache, warum die Wirkung bei den einen im Lauf der Zeit nachläßt, bei den andern nicht. Abendroth: Man ist sich offenbar in weiten Kreisen nicht klar darüber, wo die eigentlichen Schwierigkeiten liegen und was von einem reproduktiven Musiker, der doch schließlich als Verwalter unserer edelsten Musikgüter anzusprechen ist, gefordert werden darf. So erlebt man nicht selten, daß Pianisten, Dirigenten usw. die kompliziertesten Aufgaben glänzend bewältigen, um darum bei scheinbar ganz einfachen zu scheitern. Furtwängler: ...Seit Jahrzehnten erlebe ich immer dasselbe: in allen möglichen Formen. Sehen Sie die vorzügliche Pianistin X, die jüngst das Tschaikowsky-Konzert so natürlich-brillant und rassig gespielt hat. Vor einigen Jahren fing sie bei mir mit Liszt an; und wenn sie das Chopinsche e-moll-Konzert heute nicht gerade erschöpft, so gibt sie doch immerhin ein erträgliches Abbild dieses herbstlich-meisterhaften Werkes. Und nun hören Sie sich an, wie gehemmt, wie geradezu hilflos es wirkt, wenn sie an Beethoven herantritt: wie einerseits aller Glanz des Temperaments, alle Sicherheit und Sieghaftigkeit, andererseits aber auch alle Zartheit und Wärme des Gefühls aus ihrem Spiel verschwinden. Was übrig bleibt, ist dürres, akademisches Konservatorium. Das aber - und das ist daran das Schlimme - ist kein vereinzelter Fall. Es ist vielmehr heute durchaus die Regel - gleichviel, ob es sich um Dirigenten, Pianisten oder sonstige Instrumentalisten handelt. Ein ehemaliger Kollege meinte einmal gesprächsweise: Bei modernen Sachen, Strauß, Tschaikowsky, usw., könne man wirklich etwas "von sich selbst" geben, bei klassischen aber müsse man bekanntlich vor allen Dingen "stilvoll" musizieren. Woher dieses "bekanntlich"? Liegt hier ein ungeschriebenes Gesetz vor? Wie oft habe ich mich früher gefragt, warum klassischer "Stil" unbedingt mit Langeweile gleichbedeutend sein müsse! Denn es ist ja nicht wahr, daß das Maß von Sinnlichkeit und Leidenschaft, das Tschaikowsky und Verdi verlangen, größer ist als das, was Beethoven fordert. Es ist nicht wahr, daß Bach weniger "seelenvoll" ist als Puccini. Nur liegt die Seele beim einen obenauf, beim andern gleichsam im Innern. Darum ist sie natürlich beim einen nicht nur leichter zu bemerken, sondern auch leichter wiederzugeben. Es ist Erfahrungstatsache, daß, wer Beethoven - wirklich den ganzen Beethoven, den nicht "klassisch-akademisch kastrierten" - wiederzugeben imstande ist, mit Tschaikowsky und Verdi immer noch zu gutem Ende kommt, daß aber einer, der Tschaikowsky eindrucksvoll darstellt, noch lange nicht Beethovenscher oder Bachscher Musik gewachsen zu sein braucht. Von den etikettierten Beethoven-Interpreten, die bei einem Walzer von Chopin oder einer Oper von Puccini versagen, halte ich nichts. Natürlich liegt hier ein Problem verborgen. Es ist nicht ganz leicht, sich darüber klar zu werden. Versuchen wir es vom Biologischen aus: Bei der Musik der großen klassischen Meister waren Nerven, Sinne, Gemüt, Verstand gleichmäßig beteiligt. Das Einzelne wurde mit und aus dem Ganzen, das Ganze mit dem Einzelnen erfunden. Trotz der Erfüllung des Moments war alles Trachten - wie es dem natürlichen Fühlen entspricht - unbewußt selbstverständlich zugleich auf den großen Zusammenhang gerichtet. Die Impusle waren nicht weniger elementar, aber allerdings weniger nur-sinnlich, weniger nur-Nerven, nur-Gefühl als bei späterer Musik. Während des 19. Jahrhunderts verlief die Entwicklung in der Richtung der Entfesselung immer kürzerer und scheinbar - aber nur scheinbar - spontanerer Impulse. Das Musizieren wurde damit nicht, wie man glaubte, elementarer, sondern primitiver Größere Zusammenhänge, d.h. die ihnen zu Grunde liegenden seelischen Ereignisse mit dem Gefühl zu erfassen, zu gestalten, ist der heutige Musiker, ob in der Hotelhalle oder im Konzertsaal, an der Geige oder am Dirigentenpult, selten mehr geneigt oder imstande. Er ist durch das, was um ihn vorgeht, durch die Art, wie er - sowohl vom Konservatorium wie vom praktischen Leben - heutzutage erzogen wird, durch die Artung des größten Teils der Musik, die er heute unter die Hand bekommt, auf solche Aufgabe nicht mehr vorbereitet, dafür nicht mehr genügend vorgebildet. Infolgedessen lernt er einen Unterschied zu machen zwischen der Musik, bei der er "sich selbst" ist, d.h. sich selbst lebt, sich selbst musiziert, und jener anderen, bei der er - gleichsam referierend - daneben steht. Dies letztere aber nennt er dann "stilvoll" musizieren. Die überragende, in dieser Art innerhalb der Musikgeschichte nicht wieder erreichte Genialität Beethovens liegt darin, daß er scheinbar aus derselben Quelle, derselben Gesamt-"Stimmung" heraus mehrere Themen von ganz verschiedenem Einzel-Gehalt erfindet, die dann erst durch das Leben, das sich zwischen ihnen entwickelt, ganz sie selbst werden und eine neue, über die Welt des einzelnen Themas weit hinausgehende, alles überwölbende Gesamtheit darstellen. Es ist darum allerdings nicht die Genialität der Einzelerfindung allein, was für Beethoven charakteristisch ist - obwohl er auch in dieser Beziehung einiges aufzuweisen hat (und so haben diejenigen nicht so ganz unrecht, die bei ihm mehr die "Arbeit" sehen wollen). Seine Intuition geht viel weiter; denn es gelingt ihm in seinen besten Werken, eine Reihe von Themen zu finden, die irgendwie schicksalhaft, man möchte fast sagen, gesetzmäßig, zusammengehören und in ihrem Sich-Ergänzen erst den Wert, das ganze Maß von Fülle und Lebenskraft mitteilen, das ihr Schöpfer zu geben hat. Diese Methode nenne ich im eigentlichen Sinne "dramatisch". Die Themen Beethovens erleben sich aneinander wie die Gestalten eines Dramas. Innerhalb jedes Beethovenschen Werkes, ja innerhalb jedes einzelnen Satzes rollt ein Schicksal ab. . . . Es ist kein Zufall, daß der Trauermarsch nur der zweite Satz der "Eroica" ist. Die letzte Wirkung der Tragödie (über die Goethe und Schiller einen ganzen Briefwechsel geführt haben), ihre befreiende, erlösende Kraft entströmt in der Musik - es zeigt sich da der tiefe Unterschied der beiden Künste - dem Gegenteil des "Tragischen", nämlich der Freude. Hier enthüllt sich der zutiefst dionysische Charakter der Musik. Und niemand hat das mehr offenbart als Beethoven. Jede Sonate, jedes Streichquartett Beethovens ist in seiner Art, gleichviel in welcher Stimmung die einzelnen Sätze auch sein mögen, ein Drama, nicht selten eine wirkliche Tragödie, wie sie in so ekstatisch-geballter Form der Wortdichtung nicht im entferntesten möglich ist. Dies hat Richard Wagner richtig gesehen. Wo die Dichtkunst Flügel bekommt, ins Grandiose, Übermenschliche wächst, wird die Musik stets irgendwie stumm, gleichsam in sich selbst gefesselt erscheinen. Und da, wo die Dichtung überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat, sich auszudrücken, in der Ekstase, der Hingabe an die dionysische Seite in der Freude - die dem wesentlich dichterisch eingestellten Goethe ebenso fern liegt, wie sie der episch-plastischen Anschauung der Griechen fehlt (bekanntlich besaßen die Griechen auch die andere Seite) - da fängt die Musik erst an, zu zeigen, wessen sie fähig ist. Darin haben die großen Dur-Finales Beethovens - als monumentales Beispiel der Schlußsatz der IX. Sinfonie - ihren tieferen Grund. Abendroth: Aber es gibt doch nicht nur Werke dramatischen Charakters von Beethoven. Sind z.B. die sogenannten "Geraden Sinfonien" nicht deshalb vom Publikum weniger bevorzugt, weil sie undramatischer sind? Furtwängler: Der Charakter der Werke Beethovens ist reich und vielfältig wie die Natur selbst. Wenn ich sie aber dramatisch nenne, so meine ich damit nicht die "Welt" oder die "Stimmung", die sie jeweils ausdrücken, sondern die ihnen zugrunde liegende Form der Aussage. Was ich vorhin über die Art der Themenbildung erwähnte - das Zusammensetzen und Zusammenwirken in sich völlig verschiedener Teile - ist Prinzip seines Schaffens. Es bildet und durchdringt sein ganzes Werk im kleinsten wie im größten, im einzelnen Thema wie im Zerlegen des Ganzen in verschiedene Sätze, vergleichbar den einzelnen Akten eines Dramas. Denn daß auch diese Sätze einen Zusammenhang aufweisen, tief notwendig ihrer Reihenfolge, ist nicht zu leugnen. Und das Beethoven beherrschende Gefühl für den "fruchtbaren Kontrast", wie ich es kurz nennen möchte - den Kontrast, aus dem sich eine neue Einheit gebiert -, zeigt sich in seinem Werk überall mit gleicher Klarheit. Eben weil diese neue Einheit das ist, was erstrebt wird, weil jedes Stück damit eine nur ihm eigene Welt ausdrückt, ist Beethoven von unerhörter Mannigfaltigkeit. Das geht bis in die Formenwelt im einzelnen, den Stil, den Wuchs der Werke. Es gibt bei ihm nicht zwei Werke ähnlicher Gestalt, während z. B. die wenigen Werke Bruckners, was die einzelnen Formelemente (z.B. die Schlüsse) betrifft, sich gleichsehen wie ein Ei dem anderen. Gerade scheinbar unvereinbare Gegensätze werden von Beethoven geflissentlich aufgesucht. So folgt etwa einem dramatisch-aktivsten, härtesten ersten Satz (erstes Großes Beispiel dafür die Kreutzer-Sonate, letztes die Sonate op. 111) im darauffolgenden Variationensatz ein Musizieren, wie es entspannter, gelassener nicht gedacht werden kann. Erst in beiden zusammen aber stellt sich für Beethoven die ganze Natur dar. Überhaupt diese Adagio-Variationensätze, zumal der letzten Zeit! Sie kommen freilich nicht von ungefähr. Sie sind nicht Variationen im üblichen Sinn. Sie setzen voraus die Schöpfung jener Art Beethovenscher Themen, die so durchaus in sich selbst ruhen, so ganz in sich leben, daß der ganze große folgende Satz gleichsam nur ein einziges Ausatmen, Weiterschwingen, Sichausbreiten des Themas darstellt, ohne irgend ein Moment, das nicht dessen eigenstem Wesen entstammt. Und ein solcher Satz - größte Entspannung, die jemals in der Musik gewagt wurde - wird nun hineingesetzt in Außensätze, bei denen wiederum gerade die Spannung aufs höchste gesteigert erscheint. Vergegenwärtigen Sie sich die IX. Sinfonie. Das Thema des Adagio von äußerster, durchaus der religiösen Sphäre angehöriger Versunkenheit, das sich in den folgenden Variationen ausbreitet, in unendliche Verflechtungen verliert - es ist, als ob da ein Formtrieb am Werke sei, der sich sonst, kunstgeschichtlich betrachtet, in der Gotik verwirklicht haben mag. Dies alles bei Beethoven aber nicht, wie in gotischer Zeit, um seiner selbst willen, sondern eingeordnet in einen übergeordneten Zusammenhang. Mit dem erschreckend furchtbaren Eintritt des Finales scheint rückläufig erst ganz der Sinn des Adagios klar zu werden, das trotz tiefster Kontemplation nur Episode bleiben darf, Teil eines einheitlichen einzigen Schöpfungsprozesses. Nichts ist hier bloß aneinandergereiht, immer eines aus dem andern entwickelt. So vermochte es Beethoven, nicht nur diesen ersten Satz des IX. Sinfonie zu schreiben, der eine ganze Welt für sich bedeutet, dessen Inhalt und Stil ganze Musikergenerationen gebildet und überschattet hat -, er konnte ihm auch als Ergänzung und notwendiges Gegenstück das Scherzo folgen lassen, das Urbild aller sinfonischen Scherzi größten Formats -, er konnte weiter im Adagio die entgegengesetzte Seite der Welt darstellen, auch hier wie in den vorangehenden Sätzen bis zur Grenze des Erlebensmöglichen gehend - und er vermochte schließlich durch den letzten Satz alles Vorangehende erst in die Perspektive zu rücken, die ihm gemäß war, und damit die tragisch-dionysischen Fähigkeiten der Musik in ihrer ganzen Gewalt zu enthüllen. Wahrlich, das ist Schöpferkraft! Nun möchte ich noch einmal darauf zurückkommen, was Sie über den undramatischen Charakter gewisser Beethoven-Werke, besonders der "Geraden" Sinfonien, sagten. Gewiß gibt es solche Werke: ihre Anzahl ist sogar innerhalb des Beethovenschen Gesamtwerkes verhältnismäßig größer als die der mehr tragisch-dramatischen. Der Reichtum Beethovens an verschiedenartigen seelischen Stimmungen ist ja außerordentlich. Aber jede dieser Stimmungen - das ist das Charakteristische - ist mit jener ihm eigenen Entschiedenheit zum Ausdruck gebracht. Jeder Ausdruck wird bei ihm immer bis zu den in diesem Ausdruck selber liegenden Grenzen emporgetrieben. Jene Zwischenstimmungen Mozarts oder der Frühromantiker etwa, wo die Seele selber nicht weiß, wie ihr zumute ist, gibt es bei ihm ebensowenig wie jenes bürgerlich-begrenzte Verweilen, jenes Nicht-ganz-zu-Ende-gehen, das z.B. bei Schumann und Brahms häufig zu finden ist, oder jenes der Materie-verhaftet-Bleiben, über die Wirkung der angewendeten Mittel Nicht-Hinauskommen, das wir so oft bei späterer Musik finden. Besonders in seiner letzten Zeit sind es oft sehr extreme Zustände, die Beethoven ausspricht. Die aber erschwert seine Wirkung auf das große Publikum und nimmt ihr an Breite, was sie an Tiefe gewinnt. Ein Werk etwa wie die VIII. Sinfonie mit ihrer überirdischen Heiterkeit, ihrem wilden, gigantischen Humor ist - wie mir scheinen will - überhaupt nicht vielen Menschen in ihrem ganzen Umfange zugänglich. Ähnlich ist es mit der idyllisch-süßen Heiterkeit der "Pastorale", wie Wagner so schön mit dem Christuswort charakterisiert" "Mit mir seid heute im Paradiese!" Große Teile dieser Sinfonie sind erfüllt von einer Naturfrömmigkeit, einer Art Versunkenheit, die durchaus der religiösen Sphäre verwandt und sowohl bei Ausführenden wie bei Hörern heute nicht jedermanns Sache ist. Wie wenig diese Werke, die doch vor aller Augen daliegen, in der weiteren Öffentlichkeit von Musikern wie Hörern richtig verstanden werden, zeigen am besten die landläufigen Urteile resp. Vorurteile, die man immer wieder hört: - von der 'harmlos-heiteren "Achten", der "schwachen" "Pastorale", die "keinen Schluß" habe, dem "banalen" letzten Satz der "Neunten" usw. Der unbekannte Beethoven - ein Kapitel für sich, das hauptsächlich über die Unzulänglichkeit unserer Interpreten aussagt. Abendroth: Sie betonen immer wieder, dass es rein musikalische Gesetze sind, die bei den großen klassischen Werken wirkend seien. Zumal bei Beethovens Werken - um diesen als Beispiel für alle zu nehmen - sei dies deutlich aufzuzeigen. Nun ist aber nicht zu leugnen, da - unbeschadet aller rein musikalischen Gesetze - auch darüber hinaus Beethoven beim Schaffen stets offensichtlich von einer Idee ausgegangen ist. Furtwängler: Zunächst müßte da gesagt werden, daß das Wort "Idee" nur eine Bezeichnung für eine Art Verdichtungsprozeß innerhalb der wirklichen Welt ist. Es gibt in diesem Sinne überall, wo es sich um Menschliches handelt, Ideen, die sich verwirklichen wollen. Im politischen Leben etwa die verschiedenen Staatsideen, die den Völkern und politischen Schöpfern vorschweben, im religiösen Leben die verschiedenen Formgebungen und Verwirklichungen religiöser Gemeinschaft. Wenn in einem Kunstwerk, wenn z.B. in einem Musikstück eine "Idee" verkõrpert erscheint, so braucht es deshalb nicht weniger Musik zu sein. Das zu glauben, ist in Trugschluß, der entsteht, wenn wir die Idee in Worten verstandesmäßig analysierend wiederzugeben versuchen. Das ist natürlich nicht möglich, ohne den Inhalt solcher Idee weitgehend zu verflüchtigen. Mit der Wirklichkeit selber darf diese Art bewußtgewordene Idee keineswegs gleichgestellt werden. Auch bei Beethoven sind nicht die "Ideen" das Wesentliche, sondern die Art, wie er sie musikalisch verwirklicht. Gerade Beethoven hat mehr als jeder andere das Bedürfnis, alles in rein musikalische Formen aufzulösen. Das zeigt sich besonders klar in seinem Verhältnis zu einem gegebenen Text. So sehr er auch da - in einzelnen Partien des "Fidelio", der "Großen Messe" z.B. - den Sinn des einzelnen Wortes mit größter Bestimmtheit musikalisch wiederzugeben sucht, so kommt er doch von seinen rein musikalischen Formvorstellungen nicht los. Die Sonate und - als deren vereinfachter Kern - die Liedform mit ihren Wiederholungen usw. liegt ihm, wörtlich gesprochen, "im Blute"; alles wird schließlich irgendwie darauf bezogen, darauf geeinigt. Jenes lockere, gleichsam auf halbem Wege Sich-Begegnen von Musiker und Dichter finden wir bei ihm nicht. Dies ist der Grund, warum er nicht Lyriker werden konnte, wie Schubert, warum er nicht Musikdramatiker wurde wie Wagner. Nicht weil er weniger, sondern weil er mehr Musiker, mehr Nur-Musiker war; weil die rein musikalischen Forderungen stärker, unerbittlicher in ihm wirkend waren. Der Musiker in ihm fühlt sich durch einen Text nicht beflügelt, sondern gehemmt; er leidet es nicht, sich durch die textliche Gestalt des Wortes die Form seiner Musik vorschreiben zu lassen. Ganz er selbst wird daher Beethoven immer erst, wo er frei und ausschließlich der Musik und ihren immanenten Notwendigkeiten folgen kann. Deshalb versucht er meistens, einen gegebenen Text in einzelne Zustände aufzulösen, an die er dann rein musikalisch herangeht, z.B. die einzelnen Nummern des "Fidelio", von jenem wunderbaren Quartett angefangen - die edelste Eingebung bei nichtigstem Anlaß - bis zu den Sätzen der "Großen Messe", die in dieser Hinsicht geradezu als eine Sinfonie mit unterlegtem Text angesprochen werden kann. Abendroth: Das trifft auf die Komposition eines vorliegenden Textes zweifellos zu. Wie sieht es aber bei einem Vorgang wie in der "Neunten" aus, wo Beethoven nach drei Instrumentalsätzen plötzlich zum Wort greift - ist das nicht am Ende doch von einer außermusikalischen, dichterischen Idee her zu erklären? Oder gäbe es auch dafür eine rein musikalische Erklärung? Furtwängler: Allerdings gibt es eine solche. Es ist um so wichtiger, sich darüber klar zu werden, als die Begriffe über diesen letzten Satz seit Wagners einseitigen Deutungsversuchen höchst verworren sind. Zunächst wäre festzustellen, daß auch hier Beethoven dem Text als reiner Musiker gegenübertritt. Schon Wagner hat bemerkt, daß die Melodie nicht auf den Text komponiert ist, sondern daß dessen Worte der Melodie nachträglich - und nicht einmal sehr geschickt - unterlegt sind. In Wirklichkeit war es so, daß Beethoven für das, was es ihn auszusprechen drängte, was er aus dem Sinn der vorangehenden Sätze, aus dem ganzen Werk heraus als Musiker sagen wollte, den geeigneten Text suchte und ihn zufällig bei Schiller, mit dessen auf das Abstrakte, Ideelle gehender Tendenz, fand. Ein anderer, realerer Dichter hätte vielleicht nicht der Idee der Freude, sondern irgend einer besonderen, bestimmten Freude Ausdruck gegeben. Beethoven aber war das gerade recht; er wollte durch einzelne Details des Textes möglichst wenig festgelegt und in seiner musikalischen Bewegungsfreiheit gehemmt werden. Er hat ja auch von dem Schillerschen Gedicht nur wenige Strophen herausgegriffen und diese, willkürlich-wiederholt, in Musik gesetzt. Rein formal betrachtet, hat dieser letzte Satz eine zyklische Form, wie das ihm vorausgehende Adagio oder auch etwa der Schlußsatz der "Eroica" und hundert andere ähnliche Sätze bei Beethoven; es ist ein groß angelegter Variationssatz. Gewiß erscheinen die einzelnen Variationen den Erfordernissen des Textes angepaßt - auch ist ein zweites Thema mit hineinverwoben, das dann später mit dem ersten zusammen in einem Fugato erscheint -, aber der musikalische Charakter eines Variationssatzes, wenn auch größten Maßstabes, bleibt aufrechterhalten bis zum letzten Ton. Abendroth: Das Entscheidende aber ist doch die plötzliche, musikalisch scheinbar unmotivierte Heranziehung der menschlichen Stimme. Wie erklären Sie dies? Furtwängler: Die Schlußsätze sind sicherlich für Einen Komponisten wie Beethoven, in dessen Werken sich etwas "begibt", ein "Werden" sich auswirkt, jedesmal die größte und schwerste Aufgabe gewesen, denn sie waren das letzte und entscheidende Wort. Er hat dieser Aufgabe auf die verschiedenste Weise beizukommen versucht. Entweder konnte er die Spannungen, die in den übrigen Sätzen sich aufgehäuft hatten, lösen durch Finales voll Übermut und Lebenslust - darin ist Haydn ihm vorangegangen. Solche Finales gibt es viele, besonders aus der mittleren Zeit. Daneben stehen Finales, die eine wilde Lustigkeit ins Diabolische wenden, z.B. die Schlußsätze des c-moll- und cis-moll-Quartetts, auch das Moll-Finale der "Appassionata". Ein ähnliches finale hatte er scheinbar auch zuerst für die "Neunte" ins Auge gefaßt; er hat das Thema dazu später, wie wir aus Skizzen wissen, in diesem Sinne im a-moll-Quartett, op. 132, verwandt. Dann wiederum gibt es Finales, die eine Art von humoristischer Weltüberwindung darstellen, die flach erscheinen, in Wirklichkeit aber tief sind. Diese Art Schlußsätze sind der Durchschnittsmenschheit schwer verständlich. So z.B. das Finale des großen B-dur-Trios, das scheinbar gegenüber dem vorangehenden wunderbaren Adagio abfällt, in Wirklichkeit aber eine Befreiung, ein Weiterschreiten in eine leichtere, reinere Luft darstellt. Dann wiederum gibt es Rondos, wie zum ersten Male in der Sonate Pathetique, die die Spannungen der anderen Sätze in elegisch-epischer Weise ausklingen lassen. Die Möglichkeiten ihrer Schlußkrönungen sind bei Beethoven so verschieden wie die Werke selber. Wenn es ihn bei der "Neunten" zum Wort, zur menschlichen Stimme drängte, so doch nur aus einem Bedürfnis heraus, das seinen Ursprung in den vorhergehenden Sätzen, d.i. eben doch im rein Musikalischen hat. Das Thema dieses letzten Satzes als solches war es, das alles weitere, den Text, die menschliche Stimme, die zyklische Form, mit sich zog. Dieses Urbild aller Themen, eine Erfindung allein des Musikers, konnte nicht Erklärung oder Interpretation eines bestimmten Textes sein. Viel eher wirkt umgekehrt das Gedicht als eine Interpretation des Themas. Und so ist auch die herangezogene menschliche Stimme nur gleichsam als die natürliche "Instrumentation" dieser ewigen Melodie anzusprechen. Wie die Verwendung dieses "Instrumentes", der Eintritt der menschlichen Stimme als solcher aber nun musikalisch motiviert wird, darin zeigt sich die Genialität Beethovens in ganzer Größe. Ein anderer hätte wohl einfach das Rezitativ angefangen und danach den Chorsatz. Bei Beethoven, der nur musikalische Notwendigkeiten innerhalb seines Werkes anerkennt, entwickelt sich das folgendermaßen: Zunächst wird das Adagio gleichsam ins Unendliche ausgesponnen. Es ist, als ob er sich nicht genug tun, als ob er gar nicht aufhören könne. Um so schärfer kontrastieren dazu dann der schneidende Beginn des letzten Satzes und die darauffolgenden Instrumentalrezitative, die hierdurch eine eigentümliche Beredsamkeit und Bestimmtheit erhalten. Man bekommt schon hier das Gefühl, dem Finale aller Finales beizuwohnen. Damit wird auch das Bedürfnis eines Rückblicks auf die schon vergangenen Sätze, das später oft nachgeahmt wurde und das leicht etwas künstlich anmuten könnte, vollauf verständlich. Zunächst spielt sich alles rein instrumental ab: schließlich, als ersehntes Ziel, erscheint endlich das Freudenthema, zunächst in den Bässen unisono, gleichsam in seiner Urgestalt. In der Folge wird es in verschiedenen Variationen durchgeführt, bis Beethoven nach einem vorläufigen Abschluß in der Dominante - wie im Sonatensatz - wieder auf den Anfang, sozusagen als Wiederholung des ersten Teiles, zurückgreift. Nun erst erscheint dasselbe, was sich bis hierher instrumental abspielte - nämlich sowohl Rezitativ wie Freudenthema, ersteres in abgekürzter Form - unter Heranziehung der menschlichen Stimme, also gleichsam als eine Wiederholung auf höherer Ebene, eine Verdeutlichung, eine Steigerung von etwas, was schon vorher da war. Die menschliche Stimme ist hier nur noch ein Instrument mehr, das sich dem Chor der andren Instrumente hinzugesellt. Es ist das musikalische Gesetz der Steigerung durch Wiederholung - innerhalb der festgehaltenen Symmetrie eines Ganzen - das hier im großen zur Geltung kommt und das überall innerhalb der Musik, im kleinen wie im Großen, sich auswirkt. Man vergleiche hiermit etwa die kindlich-naive Art, wie Liszt in der Faust-Sinfonie den Auftritt seines Chores zu motivieren sucht. Beethoven hat es im Gegensatz dazu eben tatsächlich vermocht, etwas scheinbar so Unlogisches wie die Einführung eines von außen kommenden Gesangrezitatives und Chorsatzes in ein reines Instrumentalwerk völlig natürlich, überzeugend und künstlerische notwendig erscheinen zu lassen. Es gibt kaum ein anderes Beispiel in der ganzen Musikgeschichte, das die Möglichkeiten der reinen absoluten Musik klarer dokumentiert, das deutlicher zeigt, daß hier der Musiker und nichts als der Musiker wirkend ist. Nicht in der "Idee" an sich, sondern in der Fähigkeit, diese Idee bis zu solchem Grade in Musik zu verwandeln, liegt Beethovens Kraft. Abendroth: Woher kommt es aber, daß in Beethovensche Musik mit Vorliebe nicht nur Ideen, sondern gerade auch außer-musikalische Gedankengänge, ja ganze Dramen hineingesehen werden, viel mehr und viel hemmungsloser als in die Musik anderer großer Meister? Furtwängler: Das hängt mit einer Selbsttäuschung zusammen, die nicht schwer zu erklären ist. Man hat von jeher das Gefühl gehabt, daß bei Beethoven die Musik zu einer besonderen Art von Bestimmtheit des Ausdrucks gelangt sei. Diese Bestimmtheit nun entstammt im Grunde Beethovens Bedürfnis, alles, was er sagt, auf die knappste und einfachste Formel zu bringen. Es kennzeichnet ihn ein besonderer Wille und - ein Blick auf seine Werke lehrt das - geradezu eine besondere Fähigkeit zur Vereinfachung. Das zeigt sich in sehr aufschlußreicher Weise an den uns überkommenen Skizzenbüchern. Wir sehen hier deutlich, daß z.B. die Treffsicherheit und Einfachheit der Themenbildung nicht von vornherein vorhanden war, sondern errungen wird. Die erste Form der meisten und oftmals schönsten seiner Themen war komplizierter als die endgültige - nicht wie bei anderen von vornherein feststehend oder, wie bei den meisten Modernen, einfacher und primitiver. Der Weg seines Schaffensprozesses geht vom Chaotischen zur Gestalt, d.i. bewußt ins Einfache, nicht wie bei den Heutigen bewußt ins Komplizierte. Vor allem diese Eigenschaft ist es, die Beethoven so wesentlich von allen anderen, und zwar Vorgängern wie Nachfolgern gleicherweise, unterscheidet. Dazu kommt noch etwas, was sich in der Durchführung, in dem Schicksal dieser Themen auswirkt, und was ich schon einmal die Logik des seelischen Ablaufs genannt habe. Die Gesetze des Werdens, des Übergehens einer Stimmung in die andere, das Gefühl dafür, wie die verschiedenen Sätze eines Werkes aufeinanderfolgen müssen - das alles stellt eine Art seelischer Logik dar, die recht eigentlich die Weltwirkung der Beethovenschen Musik ausmacht. Denn diese Logik ist im eigentlichen und tiefen Sinne menschlich. Sie liegt künstlerischen Erwägungen wie menschlichen Gefühlen gleicherweise zugrunde und wird immer und zu allen Zeiten verstanden. Wieso, wieweit und warum hier nun seelische und musikalische Logik eines sind, das zu untersuchen wäre ein lohnendes Unterfangen, wäre z.B. der erste Anfang für die Beantwortung der durchaus nicht müßigen Frage, warum eine Sinfonie von Beethoven besser ist als so viele schlechte moderne Werke. Mit rein musikalisch-formalen Erörterungen oder andererseits mit bloßer Beschreibung seelischer Vorgänge ist da nichts getan. Denn es handelt sich gerade darum, das Seelische durch das Musikalische und dies wieder durch das Seelische ausgedrückt zu begreifen: daß beiden eines, nicht zu trennen sind und schon das Unterfangen, sie trennen zu wollen, ein entscheidendes Mißverstehen bedeutet. Wenn bedeutende Musiker Beethoven als Komponisten "literarischer" Inhalte ablehnen, so ist das nicht zum wenigsten auf das Konto solcher falscher Interpretationsversuche zu setzen. Der Wille zur Einfachheit, die musikalische Logik der Entwicklung verursacht jene eigene Art von Bestimmtheit, die dem empfindenden Hörer bei Beethoven immer wieder entgegentritt. Diese Bestimmtheit, obwohl, wie gesagt, nur musikalischer Art, verleitet doch die Menschen immer wieder aufs neue, hier mehr zu suchen als nur Musik und allerlei Dinge unterzulegen. Abendroth: Haben nicht den Anlaß zu Mißverständnissen gewisse Aussprüche Beethovens gegeben? Furtwängler: Es ist mir kein Ausspruch bekannt, der aus sich heraus - ohne gewaltsame Deutung - zu der Vorstellung Anlaß geben könnte, als ob Beethoven mit seinen Werken wirklich etwas anderes gemeint habe als nur sie selbst, als nur Musik. Die Wagnerschen Interpretationen - soviel Wagner sonst gerade von Beethoven wußte - sagen in diesem Fall mehr über Wagner als über Beethoven aus. Es liegt im Wesen der Musik, daß die ihr zugängliche Deutlichkeit des Ausdrucks eine andere ist als die Klarheit des Wortes; sie ist aber deshalb keineswegs weniger bestimmt. Man wird innerhalb eines Beethovenschen Werkes in keinem Moment, bei keinem Ton im Zweifel darüber sein, wo man sich innerhalb des Ganzen befindet. Freilich innerhalb eines musikalischen Ganzen. Und das muß man als solches zu hören verstehen. Beethovens Bestimmtheit naturalistisch deuten wollen im Sinne von unterlegten Dramen, von wirklichen Dichtungen, die ihn bei der Komposition angeleitet haben sollen, kann nur ein solcher, dem die rein musikalische Sprache nicht genügt. Ein solcher weiß nicht, wie unendlich groß das Maß der Bestimmtheit der Musik selber ist, wenn man sich nur ihrer Sprache hingibt, sie zu sprechen, zu verstehen vermag. Von alledem abgesehen, hat uns Beethoven - um es grob herauszusagen - weder Veranlassung noch Berechtigung gegeben, derart mit seinen Werken umzuspringen und willkürlich Dinge in sie hinein-, aus ihnen herauszulesen, die mit ihnen nichts zu tun haben. Anders verhält es sich mit den Ideen, die seine Werke verkörpern sollen. Wenn z.B. Wagner die VII. Sinfonie eine "Apotheose des Tanzes" nennt, so hat das eine gewisse Berechtigung. Es hängt das mit der schon erwähnten eigentümlichen Bestimmtheit der Beethovenschen Tonsprache zusammen, mit seiner Kraft des Gestaltens, seiner besonderen Fähigkeit, das Wesenseigene eines jeden Werkes klar herauszustellen, in sich zu vollenden, zu isolieren. In diesem Sinne stellt fast jedes Beethovensche Werk eine Idee dar, die man bei Namen nennen könnte. Nur ist damit, wie ich schon ausführte, herzlich wenig gesagt. Wem es Vergnügen macht, diese "Ideen" mit dürren Worten aufzuzeigen, den Inhalt von etwas grenzenlos Lebendigem gleichsam wie einen Schmetterling auf die spitze Nadel eines Begriffes zu spießen, der mag es tun. Ich persönlich halte mich lieber an die Werke selber. Wie aber ein Musiker denkt, für den die Form von innen heraus lebendig war, können wir - um bei dem schon oft erwähnten und am meisten bekannten Beispiel zu bleiben - bei Beethoven sehen. In einem bestimmten Falle, nämlich, als es sich darum handelte, für seine einzige Oper die Ouvertüre zu schreiben, versuchte Beethoven, sich von der ihm sonst geläufigen Sonatenform zu emanzipieren. Die II. "Leonoren-Ouvertüre" (die erste Fassung des Stückes) ist eine unmittelbare Schilderung des dramatischen Vorgangs unter Umgehung dessen, was mit der Sonatenform zusammenhängt (vor allem der sogenannten "Reprise"). Der Vergleich mit der III. "Leonoren-Ouvertüre", der späteren endgültigen Form, ist lehrreich nicht nur für die Ouvertüre selbst, sondern für Beethovens Schaffensweise überhaupt. Wagner meint, daß der gewaltige Inhalt dieser II. Ouvertüre an Kraft des Ausdrucks alles weit übertreffe, was die darauffolgende Oper "Fidelio" enthalte. Die einzige Schwäche der Ouvertüre sei nur - die Reprise, d.h. eben der Moment, wo das Stück sich als üblicher Sonatensatz statt als wirkliche unmittelbare Darstellung eines dramatischen Geschehens erweise. Wagner findet also gerade den schwachen Punkt des Stückes, wo Beethoven selbst sich - nachträglich korrigiert hat. Denn eben diese Reprise und die damit zusammenhängende breiter ausgeführte Schluß-Coda ist das, was die III. Von der II. Ouvertüre unterscheidet, und um dessentwillen Beethoven dieses Werk - was er sonst sein ganzes Leben lang nie getan hat - noch einmal schrieb. Es gibt auch heute Leute, die die II. als die ursprünglichere Fassung höher schätzen. "Ursprünglicher" ist sie nur insofern, als sie früher entstand. In Wirklichkeit haben diese Leute so wenig wie Wagner begriffen, daß das Zurückkehren zur Sonatenform für Beethoven eine Notwendigkeit, ein inneres Muß war. Daß das Gesetz der Symmetrie, der Harmonie des Ganzen, das der Sonatenform zugrunde liegt, ihn dazu zwang. Erst dadurch wurde die Steigerung, das In-die-Weite-Hinausschwingen der Coda, das zur letzten Erfüllung, das zum Ende-Bringen des musikalischen Inhalts des riesenhaften Stückes, so wie wir es in der Fassung der III. Vor uns haben, überhaupt möglich. Die Sonatenform ist für Beethoven eben - hier wie überall - nicht das Schema, das man einmal befolgen, das andere Mal nicht befolgen kann, wie es gerade beliebt. Sie wächst mit der Konzeption von selber aus der jeweiligen Musik heraus. Sie ist die unausweichliche Konsequenz einer solchen Konzeption, sie ist Beethovens Form des musikalischen Denkens überhaupt, denn sie ist eine Naturform. Jeder unbefangene Blick auf die beiden Ouvertüren wird, bei aller Würdigung der Genialität der ersten, trotzdem dem Beethoven der späteren Fassung rechtgeben. Beethoven wußte, was er tat, als er das Werk ein zweites Mal schrieb. Der Wiener Musiker Hauer hat zu Beginn unseres Jahrhunderts die "Entdeckung" gemacht, daß Beethoven eigentlich sein Leben lang nur Kadenzen geschrieben habe. Ganz im Sinne jener Jahre, in denen solch eine "Entdeckung" gemacht werden mußte, glaubte er damit zugleich den Schlüssel zur endgültigen Definition und damit Erledigung der Beethovenschen Musik gefunden zu haben. "Nur" Kadenzen: Als ob damit irgend etwas über den Sinn der Beethovenschen Musik ausgesagt würde. Es ist das nichts anderes, als wenn man sagt, daß Cäsar und Bismarck im Grunde "nur" aus Wasser oder Sauerstoff bestanden hätten. Es gehört schon ein gut Stück Begriffsarmut dazu, sich auf diese "Entdeckung" etwas zugute zu tun. Die Gesetze, nach denen ein Beethovenscher Sonatensatz gebaut ist, sind Gesetze des Seelenlebens des Menschen, des organischen Lebens. Sie sind von Grund aus und prinzipiell verschieden von denen, mit denen es die Physik und Astronomie zu tun hat. Das Material der Musik, zur Tonalität geordnet, sagt aus vom biologischen Tatsachen, nicht von physikalischen oder von kosmischen. Schlußbemerkung Wir hoffen, daß Ihnen dieses Bekanntwerden mit der Persönlichkeit dieses großen europäischen Dirigenten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viel Lesevergnügen bereitet hat und Ihnen auch einen Einblick in das damalige Musikleben erlaubte. Mit unserem Vorstellen von Künstlern wie Schnabel und Furtwängler, die beide den als Beethovennachfolger bezeichneten Komponisten Brahms entweder noch persönlich kannten (wie etwa Schnabel) oder zumindest von ihrem Alter her noch gekannt haben könnten (wie auch Furtwängler) hoffen wir auch, eine Brücke vom 19. ins 20. Jahrhundert geschlagen zu haben, von der aus wir nun auch die weitere Aufführungsgeschichte der Beethovenschen Werke in einem kontinuierlichen Zusammenhang verfolgen können. |