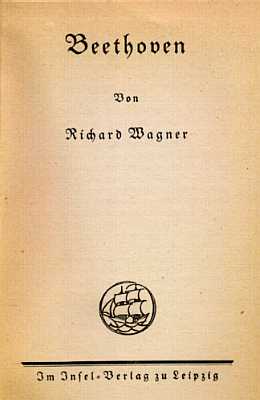|
Richard Wagner |
|
|
Vorwort
Der Verfasser der vorliegenden Arbeit fühlte sich
gedrungen, auch seinerseits zur Feier des hundertjährigen Geburtstages unseres großen
B e e t h o v e n beizutragen, und wählte, da ihm hierzu keine andre, dieser
Feier ihm würdig dünkende Veranlassung geboten war, eine schriftliche
Ausführung seiner Gedanken über die Bedeutung der Beethovenschen Musik, wie sie
ihm aufgegangen. Die Form der hieraus entstandenen Abhandlung kam ihm durch die
Vorstellung an, er sei zur Abhaltung einer Festrede bei einer idealen Feier des
großen Musikers berufen, wobei ihm, da in Wirklichkeit diese Rede nicht zu
halten war, für die Darlegung seiner Gedanken der Vorteil einer größeren
Ausführlichkeit zugut kam, als diese bei einem Vortrag vor einem wirklichen
Auditorium erlaubt gewesen wäre. Es ward ihm hierdurch möglich, den Leser durch
eine tiefergehende Untersuchung des Wesens der Musik zu geleiten und dem
Nachdenken des ernstlich Gebildeten auf diesem Wege einen Beitrag zur
Philosophie der Musik zu liefern, als welcher die vorliegende Arbeit einerseits
angesehen werden möge, während andererseits die Annahme, sie werde wirklich an
einem bestimmten Tage dieses so ungemein bedeutungsvollen Jahres vor einer
deutschen Zuhörerschaft als Rede vorgetragen, eine warme Bezugnahme auf die
erhebenden Ereignisse dieser Zeit nahelegte. Wie es dem Verfasser möglich war,
unter den unmittelbaren Eindrücken dieser Ereignisse seine Arbeit zu entwerfen
und auszuführen, möge sie demnach sich auch dieses Vorteiles erfreuen, der
größeren Erregung des deutschen Gemütes auch eine innigere Berührung mit der
Tiefe des deutschen Geistes ermöglicht zu haben, als im gewöhnlichen nationalen
Dahinleben dies gelingen dürfte.
Muß es schwierig dünken, über das wahre Verhältnis
eines großen Künstlers zu seiner Nation einen befriedigenden Aufschluß zu
geben, so steigert sich die Schwierigkeit dieser Aufgabe für den Besonnenen im allerhöchsten
Grade, sobald nicht vom Dichter oder Bildner, sondern vom Musiker die Rede sein
soll.
Daß der Dichter und der Bildner darin, wie beide die Gegebenheiten oder die
Formen der Welt auffassen, zunächst von der Besonderheit der Nation, welcher sie
angehören, bestimmt werden, ist bei ihrer Beurteilung wohl stets in das Auge
gefaßt worden. Wenn bei dem Dichter sogleich die Sprache, in welcher er
schreibt, als bestimmend für die von ihm kundzugebenden Anschauungen
hervortritt, so springt die Natur seines Landes und seines Volkes als maßgebend
für die Form und die Farbe des Bildners gewiß nicht minder bedeutend in das
Auge. Weder durch die Sprache, noch auch durch irgendwelche Form der dem Auge
wahrnehmbaren Gestalt seines Landes und Volkes hängt der Musiker mit diesen
zusammen. Man nimmt daher an, die Tonsprache gehöre der ganzen Menschheit
gleichmäßig zu und die Melodie sei die absolute Sprache, durch welche der
Musiker zu jedem Herzen rede. Bei näherer Prüfung erkennen wir nun wohl, daß
von einer deutschen Musik, im Unterschied von einer italienischen, sehr wohl
die Rede sein könne, und für diesen Unterschied darf noch ein physiologischer
nationaler Zug in Betracht genommen werden, nämlich die große Begünstigung des
Italieners für den Gesang, welche diesen für die Ausbildung seiner Musik ebenso
bestimmt habe, als der Deutsche durch Entbehrung in diesem Punkte auf sein
besonderes, ihm eigenes Tongebiet gedrängt worden wäre. Da dieser Unterschied
das Wesentliche der Tonsprache aber gar nicht berührt, sondern jede Melodie,
sei sie italienischen oder deutschen Ursprunges, gleichmäßig verstanden wird,
so kann dieses, zunächst doch wohl nur als ein ganz äußerlich aufzufassendes
Moment, nicht von dem gleichen bestimmenden Einflusse gedacht werden, als wie
die Sprache für den Dichter oder die physiognomische Beschaffenheit seines
Landes für den Bildner: denn auch in diesen sind jene äußerlichen Unterschiede
als Naturbegünstigungen oder Vernachlässigungen wiederzuerkennen, ohne daß wir
ihnen eine Geltung für den geistigen Gehalt des künstlerischen Organismus
beilegen.
Der Zug der Eigentümlichkeit, durch welchen der Musiker seiner Nation als
angehörig erkannt wird, muß jedenfalls tiefer begründet liegen als der, durch
welchen wir Goethe und Schiller als Deutsche, Rubens und Rembrandt als
Niederländer erkennen, wenngleich wir diesen und jenen endlich wohl aus dem
gleichen Grunde entstammt annehmen müssen. Diesem Grunde näher nachzuforschen,
dürfte gerade so anziehend sein, als dem Wesen der Musik selbst tiefer auf den
Grund zu gehen. Was auf dem Wege der dialektischen Behandlung bisher noch als
unerreichbar hat gelten müssen, möchte dagegen leichter sich unserem Urteile
erschließen, wenn wir uns die bestimmtere Aufgabe einer Untersuchung des
Zusammenhanges des großen Musikers, dessen hundertjährige Geburtsfeier wir zu
begehen im Begriffe sind, mit der deutschen Nation stellen, welche eben jetzt
so ernste Prüfungen ihres Wertes einging.
Fragen wir uns zunächst nach diesem Zusammenhange im äußeren Sinne, so dürfte
es bereits nicht leicht sein, einer Täuschung durch den Anschein zu entgehen.
Wenn es schon so schwer fällt, einen Dichter sich zu erklären, daß wir von
einem berühmten deutschen Literaturhistoriker die allertörichtsten Behauptungen
über den Entwickelungsgang des Shakespeareschen Genius uns gefallen lassen
mußten, so haben wir uns nicht zu verwundern, wenn wir auf noch größere
Abirrungen treffen, sobald in ähnlicher Weise ein Musiker wie B e e t h o v e n
zum Gegenstande genommen wird. Mit größerer Sicherheit ist es uns vergönnt, in
den Entwickelungsgang Goethes und Schillers zu blicken, denn aus ihren bewußten
Mitteilungen sind uns deutliche Angaben verblieben: auch diese decken uns aber
nur den Gang ihrer ästhetischen Bildung, welcher ihr Kunstschaffen mehr begleitete
als leitete, auf; über die realen Unterlagen desselben, namentlich über die
Wahl der dichterischen Stoffe, erfahren wir eigentlich nur, daß hier auffallend
mehr Zufall als Absicht waltete, eine wirkliche, mit dem Gange der äußeren
Welt- oder Volksgeschichte zusammenhängende Tendenz läßt sich dabei am
allerwenigsten erkennen. Auch über die Einwirkung ihrer Stoffe hat man bei
diesen Dichtern nur mit der größten Behutsamkeit zu schließen, um es sich nicht
entgehen zu lassen, daß diese nie unmittelbar, sondern nur in einem Sinne
mittelbar sich äußerte, welche allen sicheren Nachweis ihres Einflusses auf die
eigentliche dichterische Gestaltung unstatthaft macht. Dagegen erkennen wir aus
unseren Forschungen in diesem Betreff gerade dieses Eine mit Sicherheit, daß
ein in dieser Weise wahrnehmbarer Entwickelungsgang nur deutschen Dichtern, und
zwar den großen Dichtern jener edlen Periode der deutschen Wiedergeburt zu
eigen sein konnte.
Was wäre nun aber aus den uns aufbewahrten Briefen Beethovens und den ganz
ungemein dürftigen Nachrichten über die äußeren Vorgänge, oder gar die inneren
Beziehungen des Lebens unseres großen Musikers, auf deren Zusammenhang mit
seinen Tonschöpfungen und den darin wahrnehmbaren Entwickelungsgang zu
schließen? Wenn wir alle nur möglichen Angaben über bewußte Vorgänge in diesem
Bezug bis zu mikroskopischer Deutlichkeit besäßen, könnten sie nichts
Bestimmteres liefern, als was uns andererseits in der Nachricht vorliegt, daß
der Meister die "Sinfonia eroica" anfangs als eine Huldigung für den
jungen General Bonaparte entworfen und mit dessen Namen auf dem Titelblatte
bezeichnet hatte, diesen Namen aber später ausstrich, als er erfuhr, Bonaparte
habe sich zum Kaiser gemacht. Nie hat einer unserer Dichter eines seiner
allerbedeutendsten Werke im Betreff der damit verbundenen Tendenz mit solcher
Bestimmtheit bezeichnet: und was entnehmen wir dieser so deutlichen Notiz für
die Beurteilung eines der wunderbarsten aller Tonwerke? Können wir uns aus ihr
auch nur einen Takt dieser Partitur erklären? Muß es uns nicht als reiner
Wahnwitz erscheinen, auch nur den Versuch zu einer solchen Erklärung ernstlich
zu wagen?
Ich glaube, das Sicherste, was wir über den Menschen Beethoven erfahren können,
wird im allerbesten Falle zu dem Musiker Beethoven in dem gleichen Verhältnisse
stehen, wie der General Bonaparte zu der "Sinfonia eroica". Von
dieser Seite des Bewußtseins betrachtet, muß uns der große Musiker stets ein
vollkommenes Geheimnis bleiben. Um dieses in seiner Weise zu lösen, muß jedenfalls
ein ganz anderer Weg eingeschlagen werden als der, auf welchem es möglich ist,
wenigstens bis auf einen gewissen Punkt dem Schaffen Goethes und Schillers zu
folgen: auch dieser Punkt wird sich gerade an der Stelle verwischen, wo dieses
Schaffen aus einem bewußten in ein unbewußtes übergeht, d. h. wo der Dichter
die ästhetische Form nicht mehr bestimmt, sondern diese aus seiner inneren
Anschauung der Idee selbst bestimmt wird. Gerade aber in dieser Anschauung der
Idee liegt wiederum die gänzliche Verschiedenheit des Dichters vom Musiker
begründet, und um zu einiger Klarheit hierüber zu gelangen, haben wir uns
zuvörderst einer tiefer eingehenden Untersuchung des berührten Problems
zuzuwenden.--
Sehr ersichtlich tritt die hier gemeinte Diversität beim Bildner hervor, wenn
wir ihn mit dem Musiker zusammen halten, zwischen welchen beiden der Dichter in
der Weise in der Mitte steht, daß er mit seinem bewußten Gestalten sich dem
Bildner zuneigt, während er auf dem dunklen Boden seines Unbewußtseins sich mit
dem Musiker berührt. Bei G o e t h e war die bewußte Neigung zur bildenden
Kunst so stark, daß er in einer wichtigen Periode seines Lebens sich
geradesweges für ihre Ausübung bestimmt halten wollte, und in einem gewissen
Sinne zeit seines Lebens sein dichterisches Schaffen als eine Art von
Auskunftsbestrebung zum Ersatz für eine verfehlte Malerlaufbahn ansehen mochte:
er war mit seinem Bewußtsein ein durchaus der anschaulichen Welt zugewendeter
schöner Geist. S c h i l l e r war dagegen ungleich stärker von der Erforschung
des der Anschauung gänzlich abliegenden Unterbodens des inneren Bewußtseins
angezogen, dieses "Dinges an sich" der Kantischen Philosophie, deren
Studium in der Hauptperiode seiner höheren Entwickelung ihn gänzlich einnahm.
Der Punkt der andauernden Begegnung beider großer Geister lag genau da, wo von
beiden Extremen her eben der Dichter aus sein Selbstbewußtsein trifft. Beide
begegneten sich auch in der Ahnung vom Wesen der Musik, nur war diese Ahnung
bei Schiller von einer tieferen Ansicht begleitet als bei Goethe, welcher in
ihr, seiner ganzen Tendenz entsprechend, mehr nur das gefällige, plastisch
symmetrische Element der Kunstmusik erfaßte, durch welches die Tonkunst
analogisch wiederum mit der Architektur eine Ähnlichkeit aufweist. Tiefer faßte
Schiller das hier berührte Problem mit dem Urteile auf, welchem Goethe
ebenfalls zustimmte und durch welches dahin entschieden war, daß das Epos der
Plastik, das Drama dagegen der Musik sich zuneige. Mit unserem voranstehenden
Urteile über beide Dichter stimmt nun auch das überein, daß Schiller im
eigentlichen Drama glücklicher war als Goethe, wogegen dieser dem epischen
Gestalten mit unverkennbarer Vorliebe nachhing.
Mit philosophischer Klarheit hat aber erst Schopenhauer die Stellung der Musik
zu den anderen schönen Künsten erkannt und bezeichnet, indem er ihr eine von
derjenigen der bildenden und dichtenden Kunst gänzlich verschiedene Natur
zuspricht. Er geht hierbei von der Verwunderung darüber aus, daß von der Musik
eine Sprache geredet werde, welche ganz unmittelbar von jedem zu verstehen sei,
da es hierzu gar keiner Vermittelung durch Begriffe bedürfe, wodurch sie sich
zunächst eben vollständig von der Poesie unterscheide, deren einziges Material
die Begriffe, vermöge ihrer Verwendung zur Veanschaulichung der I d e e seien.
Nach der so einleuchtenden Definition des Philosophen sind nämlich die Ideen
der Welt und ihrer wesentlichen Erscheinungen, im Sinne des Platon aufgefaßt,
das Objekt der schönen Künste überhaupt, während der Dichter diese Ideen durch
eine eben nur seiner Kunst eigentümliche Verwendung der an sich rationalen
Begriffe dem anschauenden Bewußtsein verdeutlicht, glaubt Schopenhauer in der
Musik aber selbst eine Idee der Welt erkennen zu müssen, da derjenige, welcher
sie gänzlich in Begriffen verdeutlichen könnte, sich zugleich eine die Welt
erklärende Philosophie vorgeführt haben würde. Stellt Schopenhauer diese
hypothetische Erklärung der Musik, da sie durch Begriffe nicht eigentlich zu
verdeutlichen sei, als Paradoxon hin, so liefert er andererseits jedoch auch
das einzig ausgiebige Material zu einer weitergehenden Beleuchtung der
Richtigkeit seiner tiefsinnigen Erklärung, zu welcher selbst er sich vielleicht
nur aus dem Grunde nicht näher anließ, weil er der Musik als Laie nicht mächtig
und vertraut genug war, und außerdem seine Kenntnis von ihr sich noch nicht
bestimmt genug auf ein Verständnis eben desjenigen Musikers beziehen konnte,
dessen Werke der Welt erst jenes tiefste Geheimnis der Musik erschlossen haben,
denn gerade ist auch Beethoven nicht erschöpfend zu beurteilen, wenn nicht
jenes von Schopenhauer hingestellte tiefsinnige Paradoxon für die
philosophische Erkenntnis richtig erklärt und gelöst wird.--
In der Benutzung dieses vom Philosophen uns zugestellten Materials
glaube ich am zweckmäßigsten zu verfahren, wenn ich zunächst an eine seiner
Bemerkungen anknüpfe, mit welcher Schopenhauer die aus der Erkenntnis der
Relationen hervorgegangene Idee noch nicht als das Wesen des Dinges an sich
angesehen wissen will, sondern erst als die Offenbarung des objektiven
Charakters der Dinge, also immer nur noch ihrer Erscheinung. "Und
selbst diesen Charakter" -- so fährt Schopenhauer an der betreffenden
Stelle fort -- "würden wir nicht verstehen, wenn uns nicht das innere
Wesen der Dinge, wenigstens undeutlich und im Gefühl, anderweitig bekannt
wäre. Dieses Wesen selbst nämlich kann nicht aus den Ideen und überhaupt
nicht durch irgendeine bloß o b j e k t i v e Erkenntnis verstanden
werden, daher es ewig ein Geheimnis bleiben würde, wenn wir nicht von einer
ganz anderen Seite den Zugang dazu hätten. Nur sofern jedes Erkennende
zugleich Individuum und dadurch Teil der Natur ist, steht ihm der Zugang zum
Innern der Natur offen, in seinem eigenen Selbstbewußtsein, also wo dasselbe
sich am unmittelbarsten und alsdann als Wille sich kundgibt."(1--Die Welt
als Wille und Vorstellung [Insel=Ausg.] II, 1125.--)
Halten wir nun hierzu, was Schopenhauer als Bedingung für den Eintritt
der Idee in unser Bewußtsein fordert, nämlich "ein temporäres Überwiegen
des Intellektes über den Willen, oder physiologisch betrachtet, eine starke
Erregung der anschauenden Gehirntätigkeit, ohne alle Erregung der Neigung oder
Affekte", so haben wir nur noch die unmittelbar diesem folgende
Erläuterung hiervon scharf zu erfassen, daß unser Bewußtsein vom e i g e
n e n Selbst, welches der Wille ist, teils ein Bewußtsein hervortritt,
desto mehr weicht die andere zurück." (2-- A.g.O. 1127)
Aus einer genauen Betrachtung des hier aus dem Hauptwerke Schopenhauers
Angeführten muß es uns jetzt ersichtlich werden, daß die musikalische
Konzeption, da sie nichts mit der Auffassung einer Idee gemein haben kann (denn
diese ist durchaus an die anschauende Erkenntnis der Welt gebunden), nur in
jener Seite des Bewußtseins ihren Ursprung haben kann, welche Schopenhauer als
dem Inneren zugekehrt bezeichnet. Soll diese zum Vorteil des Eintrittes
des rein erkennenden Subjektes in seine Funktionen (d.h. die Auffassung der
Ideen) temporär gänzlich zurücktreten, so ergibt sich andererseits, daß nur aus
dieser nach innen gewendeten Seite des Bewußtseins die Fähigkeit des
Intellektes zur Auffassung des Charakters der Dinge erklärlich wird. Ist
dieses Bewußtsein aber das Bewußtsein des eigenen Selbst, also des Willens, so
muß angenommen werden, daß die Niederhaltung desselben wohl für die Reinheit
des nach außen gewendeten anschauenden Bewußtseins unerläßlich ist, daß aber
das diesem anschauenden Erkennen unerfaßliche Wesen des Dinges an sich nur
diesem nach innen gewendeten Bewußtsein ermöglicht sein würde, wenn dieses zu
der Fähigkeit gelangte, nach innen so hell zu sehen, als jenes im anschauenden
Erkennen beim Erfassen der Ideen es nach außen vermag.
Auch für das Weitergehen auf diesem Wege gibt uns Schopenhauer die
rechte Führung durch seine hiermit verbundene tiefsinnige Hypothese im Betreff
des physiologischen Phänomens des Hellsehens und seine hierauf begründete
Traumtheorie. Gelangt in jenem Phänomen nämlich das nach innen gekehrte
Bewußtsein zu wirklicher Hellsichtigkeit, d.h. zu dem Vermögen des Sehens dort,
wo unser wachendes, dem Tage zugekehrtes Bewußtsein nur den mächtigen Grund
unserer Willensaffekte dunkel empfindet, so dringt aus dieser Nacht aber auch
der Ton in die wirklich wache Wahrnehmung, als unmittelbare Äußerung des
Willens. Wie der Traum es jeder Erfahrung bestätigt, steht der vermöge
der Funktionen des wachen Gehirnes angeschauten Welt eine zweite, dieser an
Deutlichkeit ganz gleichkommende nicht minder als anschaulich sich kundgebende
Welt zur Seite, welche als Objekt jedenfalls nicht außer uns liegen kann,
demnach von einer nach innen gerichteten Funktion des Gehirnes unter nur diesem
eigenen Formen der Wahrnehmung, welche hier Schopenhauer eben das Traumorgan
nennt, dem Bewußtsein zur Erkenntnis gebracht werden muß. Eine nicht
minder bestimmte Erfahrung ist nun aber diese, daß neben der im Wachen wie im
Traume als sichtbar sich darstellenden Welt eine zweite, nur durch das Gehör
wahrnehmbare, durch den Schall sich kundgebende Welt, also recht eigentlich
eine Schallwelt neben der Lichtwelt, für unser Bewußtsein vorhanden ist, von
welcher wir sagen können, sie verhalte sich zu dieser wie der Traum zum
Wachen: sie ist uns nämlich ganz so deutlich wie jene, wenngleich wir sie
als gänzlich verschieden von ihr erkennen müssen. Wie die anschauliche
Welt des Traumes doch nur durch eine besondere Tätigkeit des Gehirnes sich
bilden kann, tritt auch die Musik nur durch eine ähnliche Gehirntätigkeit in
unser Bewußtsein, allein diese ist von der durch das S e h e n
geleiteten Tätigkeit geradeso verschieden, als jenes Traumorgan des Gehirnes
von der Funktion des im Wachen durch äußere Eindrücke angeregten Gehirnes sich
unterscheidet.
Da das Traumorgan durch äußere Eindrücke, gegen welche das Gehirn jetzt
gänzlich verschlossen ist, nicht zur Tätigkeit angeregt werden kann, so muß
dies durch Vorgänge im inneren Organismus geschehen, welche unserem wachen
Bewußtsein sich nur als dunkle Gefühle andeuten. Dieses innere Leben ist
es nun aber, durch welches wir der ganzen Natur unmittelbar verwandt, somit des
Wesens der Dinge in einer Weise teilhaftig sind, daß auf unsere Relationen zu
ihm die Formen der äußeren Erkenntnis, Zeit und Raum, keine Anwendung mehr
finden, woraus Schopenhauer so überzeugend auf die Entstehung der
vorausverkündenden oder das Fernste wahrnehmbar machenden, fatidiken Träume, ja
für seltene, äußere Fälle den Eintritt der somnambulen Hellsichtigkeit
schließt. Aus den beängstigendsten solcher Träume erwachen wir mit
einem S c h r e i, in welchem sich ganz unmittelbar der geängstigte Wille
ausdrückt, welcher sonach durch den Schrei mit Bestimmtheit zusammenwächst in
die Schallwelt eintritt, um nach außen hin sich kundzugeben. Wollen wir
nun den Schrei, in allen Abschwächungen seiner Heftigkeit bis zur zartesten Klage
des Verlangens und als das Grundelement jeder menschlichen Kundgebung an das
Gehör denken, und müssen wir finden, daß er die allerunmittelbarste Äußerung
des Willens ist, durch welche er sich am schnellsten und sichersten nach außen
wendet, so dürfen wir uns weniger über dessen unmittelbare Verständlichkeit,
als über die Entstehung einer Kunst aus diesem Elemente verwundern, da
andererseits ersichtlich ist, daß sowohl künstlerisches Schaffen als
künstlerische Anschauung nur aus der Abwendung des Bewußtseins von den
Erregungen des Willens hervorgehen kann.
Um dieses Wunder zu erklären, erinnern wir uns hier zunächst wieder der
oben angeführten Bemerkung unseres Philosophen, daß wir auch die ihrer Natur
nach nur durch willenfreie, d.h. objektive Anschauung erfaßbaren Ideen selbst
nicht verstehen würden, wenn wir nicht zu dem ihnen zum Grunde liegenden Wesen
der Dinge einen anderen Zugang, nämlich das unmittelbare Bewußtsein von uns
selbst, offen hätten. Durch dieses Bewußtsein sind wir nämlich einzig
auch befähigt, das wiederum innere Wesen der Dinge außer uns zu
verstehen, und zwar so, daß wir in ihnen dasselbe Grundwesen wiedererkennen,
welches im Bewußtsein von uns selbst als unser eigenes sich kundgibt.
Alle Täuschung hierüber ging eben nur aus dem Sehen einer Welt
außer uns hervor, welche wir im Scheine des Lichtes als etwas von uns gänzlich
verschiedenes wahrnahmen: erst durch das (geistige) Erschauen der Ideen,
also durch weite Vermittelung gelangen wir zu einer nächsten Stufe der
Enttäuschung hierüber, indem wir jetzt nicht mehr die einzelnen, zeitlich und
räumlich getrennten Dinge, sondern ihren Charakter an sich erkennen, und am
deutlichsten spricht dieser aus den Werken der bildenden Kunst zu uns, deren
eigentliches Element es daher ist, den täuschenden Schein der durch das
Licht vor uns ausgebreiteten Welt, vermöge eines höchst besonnenen Spieles mit
diesem Scheine, zur Kundgebung der von ihm verhüllten Idee derselben zu
verwenden. Dem entspricht denn auch, daß das Sehen der Gegenstände an sich
uns kalt und teilnahmslos läßt, und erst aus dem Gewahrwerden der Beziehungen
der gesehenen Objekte zu unserem Willen uns Erregungen des Affektes entstehen,
weshalb sehr richtig als erstes ästhetisches Prinzip für diese Kunst jenen
Beziehungen zu unserem individuellen Willen gänzlich auszuweichen, um dagegen
dem Sehen diejenige Ruhe zu bereiten, in welcher uns das reine Anschauen des
Objektes, dem ihm eigenen Charakter nach, einzig ermöglicht wird. Aber
immer bleibt hier das Wirksame eben nur der Schein der Dinge, in dessen
Betrachtung wir uns für die Augenblicke der willenfreien ästhetischen
Anschauung versenken. Diese Beruhigung beim reinen Gefallen am Scheine
ist es auch, welche, von der Wirkung der bildenden Kunst auf alle Künste
hinübergetragen, als Forderung für das ästhetische Gefallen überhaupt
hingestellt worden ist, und vermöge dieser den Begriff der Schönheit erzeugt
hat, wie er denn in unserer Sprache, der Wurzel des Wortes nach, deutlich mit
dem Scheine (als Objekt) und dem Schauen (als Subjekt) zusammenhängt.--
Das Bewußtsein, welches einzig auch im Schauen des Scheines uns das
Erfassen der durch ihn sich kundgebenden Idee ermöglichte, dürfte endlich sich
aber gedrungen fühlen, mit Faust auszurufen: "Welch
Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur! Wo faß ich dich,
unendliche Natur?"
Diesem Rufe antwortet nun auf das allersicherste die Musik. Hier
spricht die äußere Welt so unvergleichlich verständlich zu uns, weil sie durch
das Gehör vermöge der Klangwirkung uns ganz dasselbe mitteilt, was wir aus
tiefstem Inneren selbst ihr zurufen. Das Objekt des vernommenen Tones
fällt unmittelbar mit dem Subjekt des ausgegebenen Tones zusammen: wir
verstehen ohne jede Begriffsvermittelung, was uns der vernommene Hilfe-,
Klage-oder Freudenruf sagt, und antworten ihm sofort in dem entsprechenden
Sinne. Ist der von uns ausgestoßene Schrei Klage- oder Wonnelaut die
unmittelbarste Äußerung des Willensaffektes, so verstehen wir den gleichen,
durch das Gehör zu uns dringenden Laut auch unwidersprechlich als Äußerung
desselben Affektes, und keine Täuschung, wie im Scheine des Lichtes, ist hier
möglich, daß das Grundwesen der Welt außer uns mit dem unsrigen nicht völlig
identisch sei, wodurch jene dem Sehen dünkende Kluft sofort sich schließt.
Sehen wir nun aus diesem unmittelbaren Bewußtsein der Einheit unseres
inneren Wesens mit dem der äußeren Welt eine Kunst hervorgehen, so leuchtet es
zuvörderst ein, daß diese ganz anderen ästhetischen Gesetzen unterworfen sein
muß, als jede andere Kunst. Noch allen Ästhetikern hat es anstößig
geschienen, aus einem ihnen so dünkenden, rein pathologischen Elemente eine
wirkliche Kunst herleiten zu sollen, und sie haben diese somit erst von da an
Gültigkeit zuerkennen wollen, wo ihre Produkte in einem den Gestaltungen der
bildenden Kunst eigenen , kühlen Scheine sich uns zeigten. Daß ihr
bloßes Element aber bereits als eine Idee der Welt von uns nicht mehr erschaut,
sondern im tiefsten Bewußtsein empfunden wird, lernten wir mit so großem
Erfolge durch Schopenhauer sofort erkennen, und diese Idee verstehen wir als
eine unmittelbare Offenbarung der Einheit des Willens, welche sich unserem
Bewußtsein, von der Einheit des menschlichen Wesens ausgehend, auch als Einheit
mit der Natur, die wir ja ebenfalls durch den Schall vernehmen, unabweisbar
darstellt.
Eine Aufklärung über das Wesen der Musik als Kunst glauben wir, so
schwierig sie ist, am sichersten auf dem Wege der Betrachtung des Schaffens des
inspirierten Musikers zu gewinnen. In vieler Beziehung muß dieses von demjenigen
anderer Künstler grundverschieden sein. Von jenem hatten wir
anzuerkennen, daß ihm das willenfreie, reine Anschauen der Objekte, wie es
durch die Wirkung des vorgeführten Kunstwerkes bei dem Beschauer wieder
hervorzubringen ist, vorangegangen sein müsse. Ein solches Objekt,
welches er durch reine Anschauung zur Idee erheben soll, stellt sich dem
Musiker nun aber gar nicht dar, denn seine Musik selbst ist eine Idee der Welt,
in welcher diese ihr Wesen unmittelbar darstellt, während in jenen Künsten es,
erst durch das Erkennen vermittelt, dargestellt wird. Es ist nicht anders
zu fassen, als daß der im bildenden Künstler durch reines Anschauen zum
Schweigen gebrachte individuelle Wille im Musiker als universeller Wille wach
wird und über alle Anschauung hinaus sich als solcher recht eigentlich als
selbstbewußt erkennt. Daher denn auch der sehr verschiedene Zustand des
konzipierenden Musikers und des entwerfenden Bildners, daher die so
grundverschiedene Wirkung der Musik und der Malerei. Hier tiefste
Beschwichtigung, dort höchste Erregung des Willens: dies sagt aber nichts
anderes, als daß hier der im Individuum als solchem, somit im Wahne seiner
Unterschiedenheit von dem Wesen der Dinge außer ihm befangene Wille gedacht
wird, welcher eben erst im reinen, interesselosen Anschauen der Objekte über
seine Schranke sich erhebt, wogegen nun dort, im Musiker, der Wille sofort über
alle Schranken der Individualität hin sich einig fühlt: denn durch das
Gehör ist ihm das Tor geöffnet, durch welches die Welt zu ihm dringt, wie er zu
ihr. Diese ungeheuere Überflutung aller Schranken der Erscheinung muß im
begeisterten Musiker notwendig eine Entzückung hervorrufen, mit welcher keine
andere sich vergleichen ließe: in ihr erkennt sich der Wille als
allmächtiger Wille überhaupt: nicht stumm hat er sich vor der Anschauung
zurückzuhalten, sondern laut verkündet er sich selbst als bewußte Idee der
Welt. -- Nur ein Zustand kann den seinigen übertreffen: der des Heiligen,
-- namentlich auch weil er andauernd und untrübbar ist, wogegen die entzückende
Hellsichtigkeit des Musikers mit einem stets wiederkehrenden Zustande des
individuellen Bewußtseins abzuwechseln hat, welcher um so jammervoller gedacht
werden muß, als der begeisterte Zustand ihn höher über alle Schranken der
Individualität erhob. Aus diesem letzteren Grunde der Leiden, mit denen
er den Zustand der Begeisterung, in welchem er uns so unaussprechlich entzückt,
zu entgelten hat, dürfte uns der Musiker wieder verehrungswürdiger als andere
Künstler, ja fast mit einem Anspruch an Heilighaltung erscheinen. Denn
seine Kunst verhält sich in Wahrheit zum Komplex aller anderen Künste wie die
Religion zur Kirche.
Wir sahen, daß, wenn in den anderen Künsten der Wille gänzlich
Erkenntnis zu werden verlangt, dieses sich ihm nur so weit ermöglicht, als er
im tiefsten Innern schweigend verharrt: es ist, als erwarte er von da
außen erlösende Kunde über sich selbst, genügt ihm diese nicht, so setzt er
sich selbst in den Zustand des Hellsehens, wo er sich dann außer den Schranken
von Zeit und Raum als Ein und All der Welt erkennt. Was er hier sah, ist
in keiner Sprache mitzuteilen, wie der Traum des tiefsten Schlafes nur in die
Sprache eines zweiten, dem Erwachen unmittelbar vorausgehenden, allegorischen
Traumes übersetzt, in das wache Bewußtsein übergehen kann, schafft sich der
Wille für das unmittelbare Bild seiner Selbstschau ein zweites
Mitteilungsorgan, welches, während es mit der einen Seite seiner inneren Schau
zugekehrt ist, mit der anderen die mit dem Erwachen nun wieder hervortretende
Außenwelt durch einzig unmittelbar sympathische Kundgebung des Tones
berührt. Er ruft, und an dem Gegenruf erkennt er sich auch wieder:
so wird ihm Ruf und Gegenruf ein tröstendes, endlich ein entzückendes Spiel mit
sich selbst.
In schlafloser Nacht trat ich einst auf den Balkon meines Fensters
am großen Kanal in Venedig: wie ein tiefer Traum lag die märchenhafte
Lagunenstadt im Schatten vor mir ausgedehnt. Aus dem lautlosesten
Schweigen erhob sich da der mächtige rauhe Klageruf eines soeben auf seiner
Barke erwachten Gondoliers, mit welchem dieser in wiederholten Abständen in die
Nacht hineinruft, bis aus weitester Ferne der gleiche Ruf dem nächtlichen Kanal
entlang antwortete: ich erkannte die uralte, schwermütige melodische Phrase,
welcher seinerzeit auch die bekannten Verse Tassos untergelegt worden, die aber
an sich gewiß so alt ist, als Venedigs Kanäle mit ihrer
Bevölkerung. Nach feierlichen Pausen belebte sich endlich der weithin
tönende Dialog und schien sich im Einklang zu verschmelzen, bis aus der Nähe
wie aus der Ferne sanft das Tönen wieder im neugewonnenen Schlummer
erlosch. Was konnte mir das von der Sonne bestrahlte, bunt durchwimmelte
Venedig des Tages von sich sagen, das jener tönende Nachttraum mir nicht unendlich
tiefer unmittelbar zum Bewußtsein gebracht gehabt hätte? -- Ein anderes Mal
durchwanderte ich die erhabene Einsamkeit eines Hochtales von Uri. Es war
heller Tag, als ich von einer hohen Alpenweide zur Seite her den grell
jauchzenden Reigenruf eines Sennen vernahm, den er über das weite Tal
hinübersandte, bald antwortete ihm von dort her durch das ungeheuere Schweigen
der gleiche übermütige Hirtenruf: hier mischte sich nun das Echo der
ragenden Felswände hinein, im Wettkampfe ertönte lustig das ernst schweigsame
Tal. -- So erwacht das Kind aus der Nacht des Mutterschoßes mit dem Schrei des
Verlangens und antwortet ihm die beschwichtigende Liebkosung der Mutter, so
versteht der sehnsüchtige Jüngling den Lockgesang der Waldvögel, so spricht die
Klage der Tiere, der Lüfte, das Wutgeheul der Orkane zu dem sinnenden Manne,
über den nun jener traumhafte Zustand kommt, in welchem er durch das Gehör das
wahrnimmt, worüber ihn sein Sehen in der Täuschung der Zerstreutheit erhielt,
nämlich daß sein innerstes Wesen mit dem innersten Wesen alles jenes
Wahrgenommenen auch das Wesen der Dinge außer ihm wirklich erkannt wird.
Den traumartigen Zustand, in welchen die bezeichneten Wirkungen durch
das sympathische Gehör versetzen und in welchem uns daher jene andere Welt aufgeht,
aus welcher der Musiker zu uns spricht, erkennen wir sofort aus der einem jeden
zugänglichen Erfahrung, daß durch die Wirkung der Musik auf uns das Gesicht in
der Weise depontenziert wird, daß wir mit offenen Augen nicht mehr intensiv
sehen. Wir erfahren dies in jedem Konzertsaal während der Anhörung eines
uns wahrhaft ergreifenden Tonstückes, wo das Allerzerstreuendste und an sich
Häßlichste vor unseren Augen vorgeht, was uns jedenfalls, wenn wir es intensiv
sähen, von der Musik gänzlich abziehen und sogar lächerlich gestimmt machen
würde, nämlich, außer dem sehr trivial berührenden Anblicke der Zuhörerschaft,
die mechanischen Bewegungen der Musiker, der ganze sonderbar sich bewegende
Hilfsapparat einer orchestralen Produktion. Daß dieser Anblick, welcher
den nicht von der Musik Ergriffenen einzig beschäftigt, den von ihr Gefesselten
endlich gar nicht mehr stört, zeigt uns deutlich, daß wir ihn nicht mehr mit
Bewußtsein gewahr werden, dagegen nun mit offenen Augen in den Zustand geraten,
welcher mit dem des somnambulen Hellsehens eine wesentliche Ähnlichkeit
hat. Und in Wahrheit ist es auch nur dieser Zustand, in welchem wir der
Welt des Musikers unmittelbar angehörig werden. Von dieser, sonst mit
nichts zu schildernden Welt aus legt der Musiker durch die Fügung seiner Töne
gewissermaßen das Netz nach uns aus, oder auch er besprengt mit den
Wundertropfen seiner Klänge unser Wahrnehmungsvermögen in der Weise, daß er es
für jede andere Wahrnehmung, als die unserer eigenen inneren Welt, wie durch Zauber
außer Kraft setzt.
Wollen wir uns nun sein Verfahren hierbei einigermaßen verdeutlichen, so
könnten wir dies immer nur wieder am besten, indem wir auf die Analogie
desselben mit dem inneren Vorgange zurückkommen, durch welchen, nach
Schopenhauers so lichtvoller Annahme, der dem wachen zerebralen Bewußtsein
gänzlich entrückte Traum des tiefsten Schlafes sich in den leichteren, dem
Erwachen unmittelbar vorausgehenden, allegorischen Traum gleichsam
übersetzt. Das analogisch in Betracht genommene Sprachvermögen erstreckt
sich für den Musiker vom Schrei des Entsetzens bis zur Übung des tröstlichen
Spieles der Wohllaute. Da er in der Verwendung der hier zwischenliegenden
überreichen Abstufungen gleichsam von dem Drange nach einer verständlichen
Mitteilung des innersten Traumbildes bestimmt wird, nähert er sich, wie der
zweite, allegorische Traum, den Vorstellungen des wachen Gehirnes, durch welche
dieses endlich das Traumbild zunächst für sich festzuhalten vermag. In
dieser Annäherung berührt er aber, als äußeres Moment seiner Mitteilung, nur
die Vorstellungen der Z e i t , während er diejenigen des Raumes in dem
undurchdringlichen Schleier erhält, dessen Lüftung sein erschautes Traumbild
sofort unkenntlich machen müßte. Während die weder dem Raume noch der Zeit
angehörige Harmonie der Töne das eigentlichste Element der Musik verbleibt,
reicht der nun bildende Musiker der wachenden Erscheinungswelt durch die
r h y t h m i s c h e Zeitfolge seiner Kundgebungen gleichsam die Hand
zur Verständigung, wie der allegorische Traum an die gewohnten Vorstellungen
des Individuums in der Weise anknüpft, daß das der Außenwelt zugekehrte wache
Bewußtsein, wenngleich es die große Verschiedenheit auch dieses Traumbildes von
dem Vorgange des wirklichen Lebens sofort erkennt, es dennoch festhalten
kann. Durch die r h y t h m i s c h e Anordnung seiner Töne
tritt somit der Musiker in eine Berührung mit der anschaulichen plastischen
Welt, nämlich vermöge der Ähnlichkeit der Gesetze, nach welchen die Bewegung sichtbarer
Körper unserer Anschauung verständlich sich kundgibt. Die menschliche
Gebärde, welche im Tanze durch ausdrucksvoll wechselnde gesetzmäßige Bewegung
sich verständlich zu machen sucht, scheint somit für die Musik das zu sein, was
die Körper wiederum für das Licht sind, welches ohne die Brechung an diesen
nicht leuchten würde, während wir sagen können, daß ohne den Rhythmus uns die
Musik nicht wahrnehmbar sein würde. Eben hier, auf dem Punkte des
Zusammentreffens der Plastik mit der Harmonie, zeigt sich aber das nur nach der
Analogie des Traumes erfaßbare Wesen der Musik sehr deutlich als ein von dem
Wesen namentlich der bildenden Kunst gänzlich verschiedenes, wie diese von der
Gebärde, welche sie nur im Raum fixiert, die Bewegung der reflektierenden
Anschauung zu supplieren überlassen muß, spricht die Musik das innerste Wesen
der Gebärde mit solch unmittelbarer Verständlichkeit aus, daß sie, sobald wir
ganz von der Musik erfüllt sind, sogar unser Gesicht für die intensive
Wahrnehmung der Gebärde depotenziert, so daß wir sie endlich verstehen, ohne
sie selbst zu sehen. Zieht somit die Musik selbst die ihr verwandtesten
Momente der Erscheinungswelt in ihr von so bezeichnetes Traumbereich, so
geschieht dies doch nur, um die anschauende Erkenntnis durch eine mit ihr vorgehende
wunderbare Umwandlung gleichsam nach innen zu wenden, wo sie nun befähigt wird,
das Wesen der Dinge in seiner unmittelbarsten Kundgebung zu erfassen, gleichsam
das Traumbild zu deuten, das der Musiker im tiefsten Schlafe selbst erschaut
hatte. --
Über das Verhalten der Musik zu den plastischen Formen der
Erscheinungswelt, sowie zu den von den Dingen selbst abgezogenen Begriffen kann
unmöglich etwas Lichtvolleres hervorgebracht werden, als was wir hierüber in
Schopenhauers Werke an der betreffenden Stelle lesen, weswegen wir uns von
einem überflüssigen Verweilen hierbei zu der eigentlichen Aufgabe dieser
Untersuchungen, nämlich der Erforschung der Natur des Musikers, selbst wenden.
Nur haben wir zuvor noch bei einer wichtigen Entscheidung im Betreff des
ästhetischen Urteils über die Musik als Kunst zu verweilen. Wir finden
nämlich, daß aus den Formen der Musik, mit welchen diese sich der äußeren
Erscheinung anzuschließen scheint, eine durchaus sinnlose und verkehrte
Anforderung an den Charakter ihrer Kundgebungen entnommen worden ist. Wie
dies zuvor schon erwähnt war, sind auf die Musik Ansichten übertragen worden,
welche lediglich der Beurteilung der bildenden Kunst entstammen. Daß diese
Verirrung vor sich gehen konnte, haben wir jedenfalls der zuletzt bezeichneten
äußeren Annäherung der Musik an die anschauliche Seite der Welt und ihrer
Erscheinungen zuzuschreiben. In dieser Richtung hat wirklich die
musikalische Kunst einen Entwickelungsprozeß durchgemacht, welcher sie der
Mißverständlichkeit ihres wahren Charakters so weit aussetzte, daß man von ihr
eine ähnliche Wirkung wie von den Werken der bildenden Kunst, nämlich die
Erregung des Gefallens an schönen Formen, forderte: Da
hierbei zugleich ein zunehmender Verfall des Urteils über die bildende Kunst
selbst mit unterlief, so kann leicht gedacht werden, wie tief die Musik
hierdurch erniedrigt war, wenn im Grunde von ihr gefordert wurde, sie sollte
ihr eigenstes Wesen völlig darniederhalten, um nur durch Zukehrung ihrer
äußerlichen Seite unsere Ergetzung zu erregen.
Die Musik, welche einzig dadurch zu uns spricht, daß sie den
allerallgemeinsten Begriff des an sich dunklen Gefühles in den erdenklichsten
Abstufungen mit bestimmtester Deutlichkeit uns belebt, kann an und für sich
einzig nach der Kategorie des Erhabenen beurteilt werden, da sie,
sobald sie uns erfüllt, die höchste Ekstase des Bewußtseins der
Schrankenlosigkeit erregt. Was dagegen erst infolge der Versenkung
in das Anschauen des Werkes der bildenden Kunst bei uns eintritt, nämlich die durch
das Fahrenlassen der Relationen des angeschauten Objektes zu unserem
individuellen Willen endlich gewonnene (temporäre) Befreiung des Intellektes
vom Dienste jenes Willens, also die geforderte Wirkung der Schönheit auf
das Gemüt, diese übt die Musik sofort bei ihrem ersten Eintritte aus, indem sie
den Intellekt sogleich von jedem Erfassen der Relationen der Dinge außer uns
abzieht und als reine, von jeder Gegenständlichkeit befreite Form uns gegen die
Außenwelt gleichsam abschließt, dagegen nun uns einzig in unser Inneres, wie in
das innere Wesen aller Dinge blicken läßt. Demnach hätte also das Urteil
über eine Musik sich auf die Erkenntnis derjenigen Gesetze zu stützen, nach
welchen von der Wirkung der schönen Erscheinung, welche die allererste Wirkung
des bloßen Eintrittes der Musik ist, zur Offenbarung ihres eigensten
Charakters, durch die Wirkung des Erhabenen, am unmittelbarsten fortgeschritten
wird. Der Charakter einer recht eigentlich nichtssagenden Musik wäre es
dagegen, wenn sie beim prismatischen Spiele mit dem Effekte ihres ersten
Eintrittes verweilte und uns somit beständig nur in den Relationen erhielte,
mit welchen die äußerste Seite der Musik sich der anschaulichen Welt zukehrt.
Wirklich ist der Musik eine andauernde Entwickelung einzig nach dieser
Seite hin gegeben worden, und zwar durch ein systematisches Gefüge ihres
rhythmischen Periodenbaues, welches sie einerseits in einen Vergleich mit der
Architektur gebracht, andererseits ihr eine Überschaulichkeit gegeben hat,
welche sie eben dem berührten falschen Urteile nach Analogie der bildenden
Kunst aussetzen mußte. Hier, in ihrer äußersten Eingeschränktheit in
banale Formen und Konventionen, dünkte sie z.B. Goethe so glücklich verwendbar
zur Normierung dichterischer Konzeptionen. In diesen konventionellen
Formen mit dem ungeheueren Vermögen der Musik nur so spielen zu können, daß
ihrer eigentlichen Wirkung, der Kundgebung des inneren Wesens aller Dinge,
gleich einer Gefahr durch Überflutung, ausgewichen werde, galt lange dem
Urteile der Ästhetiker als das wahre und einzig erfreuliche Ergebnis der
Ausbildung der Tonkunst. Durch diese Formen aber zu dem innersten Wesen
der Musik in der Weise durchgedrungen zu sein, daß er von dieser Seite her das
innere Licht des Hellsehenden wieder nach außen zu werfen vermochte, um auch
diese Formen nur nach ihrer inneren Bedeutung uns wieder zu zeigen, dies war
das Werk unseres großen Beethoven, den wir daher als den wahren
Inbegriff des Musikers uns vorzuführen haben. --
Wenn wir, dem Festhalten der öfter angezogenen Analogie des
allegorischen Traumes, uns die Musik, von einer innersten Schau angeregt, nach
außen hin diese Schau mitteilend denken wollen, so müssen wir als das
eigentliche Organ hierfür, wie dort das Traumorgan, eine zerebrale Befähigung annehmen,
vermöge welcher der Musiker zuerst das aller Erkenntnis verschlossene innere
An-sich wahrnimmt, ein nach innen gewendetes Auge, welches nach außen gerichtet
zum Gehör wird. Wollen wir das von ihm wahrgenommene innerste
(Traum-)Bild der Welt in seinem getreuesten Abbilde uns vorgeführt denken, so
vermögen wir dies in ahnungsvollster Weise, wenn wir eines jener berühmten
Kirchenstücke Palestrinas anhören. Hier ist der Rhythmus nur erst
noch durch den Wechsel der harmonischen Akkordfolgen wahrnehmbar, während er
ohne diese, als symmetrische Zeitfolge für sich, gar nicht existiert, hier ist
demnach die Zeitfolge noch so unmittelbar an das an sich zeit- und raumlose
Wesen der Harmonie gebunden, daß die Hilfe der Gesetze der Zeit für das
Verständnis einer solchen Musik noch gar nicht zu verwenden ist. Die
einzige Zeitfolge in einem solchen Tonstücke äußert sich fast nur in den
zartesten Veränderungen einer Grundfarbe, welche die mannigfaltigsten Übergänge
im Festhalten ihrer weitesten Verwandtschaft uns vorführt, ohne daß wir eine
Zeichnung von Linien in diesem Wechsel wahrnehmen können. Da nun diese
Farbe selbst aber nicht im Raume erscheint, so erhalten wir hier ein fast
ebenso zeit- als raumloses Bild, eine durchaus geistige Offenbarung, von welcher
wir daher mit so unsäglicher Rührung ergriffen werden, weil sie uns zugleich
deutlicher als alles andere das innerste Wesen der Religion, frei von jeder
dogmatischen Begriffsfiktion, zum Bewußtsein bringt.
Vergegenwärtigen wir uns jetzt hier wieder ein Tanzmusikstück, oder
einen dem Tanzmotive nachgebildeten Orchestersymphoniesatz, oder endlich eine
eigentliche Opernpiece, so finden wir unsere Phantasie sogleich durch eine
regelmäßige Anordnung in der Wiederkehr rhythmischer Perioden gefesselt, durch
welche sich zunächst die Eindringlichkeit der Melodie, vermöge der ihr
gegebenen Plastizität, bestimmt. Sehr richtig hat man die auf diesem Wege
ausgebildete Musik mit "weltlich" bezeichnet, im Gegensatze zu jener
"geistlichen". Über das Prinzip dieser Ausbildung habe ich mich
anderwärts deutlich genug ausgesprochen (3--namentlich tat ich dies in Kürze
und im allgemeinen in einer "Zukunftsmusik" betitelten Abhandlung,
welche vor etwa zwölf Jahren [1860] in Leipzig veröffentlicht wurde, ohne
jedoch irgendwelche Beachtung zu finden) und fasse dagegen hier die Tendenz
derselben nur in dem bereits oben berührten Sinne der Analogie mit dem
allegorischen Traume auf, demnach es scheint, als ob jetzt das wach gewordene
Auge des Musikers an den Erscheinungen der Außenwelt so weit haftet, als diese
ihm ihrem inneren Wesen nach sofort verständlich werden. Die äußeren
Gesetze, nach welchen dieses Haften an der Gebärde, endlich an jedem
bewegungsvollen Vorgange des Lebens sich vollzieht, werden ihm zu denen der
Rhythmik, vermöge welcher er Perioden der Entgegenstellung und der Wiederkehr
konstruiert. Je mehr diese Perioden nun von dem eigentlichen Geiste der
Musik erfüllt sind, desto weniger werden sie als architektonische Merkzeichen
unsere Aufmerksamkeit von der reinen Wirkung der Musik ableiten. Hingegen
wird da, wo jener zur Genüge bezeichnete innere Geist der Musik, zugunsten
dieser regelmäßigen Säulenordnung der rhythmischen Einschnitte, in seiner
eigensten Kundgebung sich abschwächt, nur jene äußerliche Regelmäßigkeit uns
noch fesseln, und wir werden notwendig unsere Forderungen an die Musik selbst
herabstimmen, indem wir sie jetzt hauptsächlich nur auf jene Regelmäßigkeit
beziehen. -- Die Musik tritt hierdurch aus dem Stande ihrer erhabenen Unschuld,
sie verliert die Kraft der Erlösung von der Schuld der Erscheinung, d.h. sie
ist nicht mehr Verkünderin des Wesens der Dinge, sondern sie selbst wird in die
Täuschung der Erscheinung der Dinge außer uns verwebt. Denn zu dieser
Musik will man nun auch etwas sehen, und dieses Zu-Sehende wird dabei
zur Hauptsache, wie dies die "Oper" recht deutlich zeigt, wo das
Spektakel, das Ballett usw. das Anziehende und Fesselnde ausmachen, was
ersichtlich genug die Entartung der hierfür verwendeten Musik herausstellt. --
Das bisher Gesagte wollen wir uns nun durch ein näheres Eingehen auf den
Entwickelungsgang des Beethovenschen Genius verdeutlichen, wobei wir uns
zunächst, um aus der Allgemeinheit unserer Darstellung herauszutreten, den
praktischen Gang der Ausübung des eigentümlichen Stiles des Meisters in das
Auge zu fassen haben. --
Die Befähigung eines Musikers für seine Kunst, seine Bestimmung für sie,
kann ich gewiß nicht anders herausstellen, als durch die auf ihn sich
kundgebende Wirkung des Musizierens außer ihm. In welcher Weise hiervon
seine Fähigkeiten zur inneren Selbstschau, jener Hellsichtigkeit des tiefsten
Welttraumes, angeregt worden ist, erfahren wir erst am voll erreichten Ziele
seiner Selbstentwickelung, denn bis dahin gehorcht er den Gesetzen der
Einwirkung äußerer Eindrücke auf ihn, und für den Musiker leiten sich diese
zunächst von den Tonwerken der Meister seiner Zeit her. Hier finden wir
nun Beethoven von den Werken der Oper am allerwenigsten angeregt, wogegen ihm
Eindrücke von der Kirchenmusik seiner Zeit näher lagen. Das Metier des
Klavierspielers, welches er, um als Musiker "etwas zu sein", zu
ergreifen hatte, brachte ihn aber in andauernde und vertrauteste Berührung mit
den Klavierkompositionen der Meister seiner Periode. In dieser
hatte sich die "Sonate" als Musterform herausgebildet. Man kann
sagen, Beethoven war und blieb Sonatenkomponist, denn für seine allermeisten
und vorzüglichsten Instrumentalkompositionen war die Grundform der Sonate das
Schleiergewebe, durch welches es in das Reich der Töne blickte, oder auch durch
welches er, aus diesem Reiche auftauchend, sich uns verständlich machte,
während andere, namentlich die gemischten Vokalmusikformen, von ihm, trotz der
ungemeinsten Leistungen in ihnen, doch nur vorübergehend, wie versuchsweise
berührt wurden.
Die Gesetzmäßigkeit der Sonatenform hatte sich durch Emanuel Bach, Haydn
und Mozart für alle Zeiten gültig ausgebildet. Sie war der Gewinn eines
Kompromisses, welchen der deutsche mit dem italienischen Musikgeiste
eingegangen war. Ihr äußerlicher Charakter war ihr durch die Tendenz
ihrer Verwendung verliehen: mit der Sonate präsentierte sich der
Klavierspieler vor dem Publikum, welches er durch seine Fertigkeit als solcher
ergetzen und zugleich als Musiker angenehm unterhalten sollte. Dies war nun
nicht mehr Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der Kirche vor der Orgel
versammelte oder den Kenner und Genossen zum Wettkampfe dahin berief, eine
weite Kluft trennte den wunderbaren Meister der Fuge von den Pflegern der
Sonate. Die Kunst der Fuge ward von diesen als ein Mittel der Befestigung
des Studiums der Musik erlernt, für die Sonate aber nur als Künstlichkeit
verwendet: die rauhen Konsequenzen der reinen Kontrapunktik wichen dem
Behagen an einer stabilen Eurythmie, deren fertiges Schema im Sinne
italienischer Euphonie auszufüllen einzig den Forderungen an die Musik zu
entsprechen schien. In der Haydnschen Instrumentalmusik glauben wir den
gefesselten Dämon der Musik mit der Kindlichkeit eines geborenen Greises vor
uns spielen zu sehen. Nicht mit Unrecht hält man die früheren Arbeiten
Beethovens für besonders dem Haydnschen Vorbilde entsprungen, ja selbst in der
reiferen Entwickelung seines Genius glaubt man ihm nähere Verwandtschaft mit
Haydn als mit Mozart zusprechen zu müssen. Über die eigentümliche
Beschaffenheit dieser Verwandtschaft gibt nun ein auffallender Zug in dem
Benehmen Beethovens gegen Haydn Aufschluß, welchen er als seinen Lehrer, für
den er gehalten ward, durchaus nicht anerkennen wollte und gegen welchen er
sich sogar verletzende Äußerungen seines jugendlichen Übermutes
erlaubte. Es scheint, er fühlte sich Haydn verwandt wie der geborene Mann
dem kindlichen Greise. Weit über die formelle Übereinstimmung mit seinem
Lehrer hinaus drängte ihn der unter jener Form gefesselte unbändige Dämon
seiner inneren Musik zu einer Äußerung seiner Kraft, die, wie alles Verhalten
des ungeheueren Musikers, sich eben nur mit unverständlicher Rauheit kundgeben
konnte. -- Von seiner Begegnung als Jüngling mit Mozart wird uns erzählt, er
sei unmutig vom Klaviere aufgesprungen, nachdem er dem Meister zu seiner
Empfehlung eine Sonate vorgespielt hatte, wogegen er nun, um sich besser zu
erkennen zu geben, frei phantasieren zu dürfen verlangte, was er denn auch, wie
wir vernehmen, mit so bedeutendem Eindruck auf Mozart ausführte, daß dieser
seinen Freunden sagte: "Von dem wird die Welt etwas zu hören
bekommen." Dies wäre eine Äußerung Mozarts zu einer Zeit gewesen, wo
dieser selbst mit deutlichem Selbstgefühle einer Entfaltung seines inneren
Genius zureifte, welche bis dahin aus eigenstem Triebe sich zu vollziehen durch
die unerhörten Abwendungen im Zwange einer jammervoll mühseligen
Musikerlaufbahn aufgehalten worden war. Wir wissen, wie er seinem allzu
früh nahenden Tode mit dem bitteren Bewußtsein entgegensah, daß er nun erst
dazu gelangt sein würde, der Welt zu zeigen, was er eigentlich in der Musik
vermöge.
Dagegen sehen wir den jungen Beethoven der Welt sogleich mit dem
trotzigen Temperamente entgegentreten, das ihn sein ganzes Leben hindurch in einer
fast wilden Unabhängigkeit von ihr erhielt: sein ungeheueres, vom
stolzesten Mute getragenes Selbstgefühl gab ihm zu jeder Zeit die Abwehr der
frivolen Anforderungen der genußsüchtigen Welt an die Musik ein. Gegen
die Zudringlichkeit eines verweichlichten Geschmackes hatte er einen Schatz von
unermeßlichem Reichtum zu wahren. In denselben Formen, in welchen die
Musik sich nur noch als gefällige Kunst zeigen sollte, hatte er die Wahrsagung
der innersten Tonweltschau zu verkündigen. So gleicht er zu jeder Zeit
einem wahrhaft Besessenen, denn von ihm gilt, was Schopenhauer vom Musiker
überhaupt sagt: dieser spreche die höchste Weisheit aus in einer Sprache,
die seine Vernunft nicht verstehe.
Der "Vernunft" seiner Kunst begegnete er nur in dem Geiste,
welcher den formellen Aufbau ihres äußeren Gerüstes ausgebildet hatte.
Das war denn eine gar dürftige Vernunft, die aus diesem architektonischen
Periodengerüste zu ihm sprach, wenn er vernahm, wie selbst die großen Meister
seiner Jugendzeit darin mit banaler Wiederholung von Phrasen und Floskeln, mit
den genau eingeteilten Gegensätzen von stark und sanft, mit den vorschriftlich
rezipierten gravitätischen Einleitungen von so und so vielen Takten, durch die
unerläßliche Pforte von so und so vielen Halbschlüssen zu der seligmachenden
lärmenden Schlußkadenz sich bewegten. Das war die Vernunft, welche die
Opernarie konstruiert, die Anreihung der Opernpiecen aneinander diktiert hatte,
durch welche Haydn sein Genie an das Abzählen der Perlen eines Rosenkranzes fesselte.
Denn mit Palestrinas Musik war auch die Religion aus der Kirche geschwunden,
wogegen nun der künstliche Formalismus der jesuitischen Praxis die Religion wie
zugleich die Musik konreformierte. So verdeckt der gleiche jesuitische Baustil
der zwei letzten Jahrhunderte den sinnvollen Beschauer das ehrwürdig edle Rom,
so verweichlichte und versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei, so
entstand, unter der gleichen Anleitung, die "klassische" französische
Poesie, in deren geisttötenden Gesetzen wir eine recht sprechende Analogie mit
den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate auffinden können.
Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und
gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem
Gebiete der Kunst, dieser künstlich geleiteten Verderbnis des europäischen
Völkergeistes erlösend entgegentrat. Haben wir auf anderen Gebieten
unsere Lessing, Goethe, Schiller u.a. als unsere Erretter von dem Verkommen in
jener Verderbnis gefeiert, so gilt es nun heute, an diesem Musiker Beethoven
nachzuweisen, daß durch ihn, da er denn in der reinsten Sprache aller Völker
redete, der deutsche Geist den Menschengeist von tiefer Schmach erlöste.
Denn indem er die zur bloßen gefälligen Kunst herabgesetzte Musik aus ihrem
eigensten Wesen zu der Höhe ihres erhabenen Berufes erhob, hat er uns das
Verständnis derjenigen Kunst erschlossen, aus welcher die Welt jedem Bewußtsein
so bestimmt sich erklärt, als die tiefste Philosophie sie nur dem
begriffskundigen Denker erklären könnte. Und hierin einzig liegt das
Verhältnis des großen Beethoven zur deutschen Nation begründet, welches wir uns
nun auch in den unserer Kenntnis vorliegenden besonderen Zügen seines Lebens
und Schaffens näher zu verdeutlichen suchen wollen. --
Darüber, wie sich das künstlerische Verfahren zu dem Konstruieren nach
Vernunftbegriffen verhält, kann nichts einen belehrenderen Aufschluß geben, als
ein getreues Auffassen des Verfahrens, welchem Beethoven in der Entfaltung
seines musikalischen Genius folgte. Ein Verfahren aus Vernunft wäre es
gewesen, wenn er mit Bewußtsein die vorgefundenen äußeren Formen der Musik
umgeändert oder gar umgestoßen hätte; hiervon treffen wir aber nie auf eine
Spur. Gewiß hat es nie einen weniger über seine Kunst nachdenkenden
Künstler gegeben, als Beethoven. Dagegen zeigt uns die schon erwähnte
rauhe Heftigkeit seines menschlichen Wesens, wie er den Bann, in welchem jene
Formen seinen Genius hielten, fast so unmittelbar als jeden anderen Zwang der
Konvention mit dem Gefühle eines persönlichen Leidens empfand. Seine
Reaktion hiergegen bestand aber einzig in der übermütig freien, durch nichts,
selbst durch jene Formen nicht zu hemmenden Entfaltung seines inneren
Genius. Nie änderte er grundsätzlich eine jener vorgefundenen Formen der
Instrumentalmusik, in seinen letzten Sonaten, Quartetten, Symphonien usw. ist
die gleiche Struktur wie in seinen ersten unverkennbar nachzuweisen. Nun
aber vergleiche man diese Werke miteinander, man halte z.B. die achte Symphonie
in F-Dur zu der zweiten in D, und staune über die völlig neue Welt, welche uns
dort in der fast ganz gleichen Form entgegentritt!
Hier zeigt sich denn wieder die Eigentümlichkeit der deutschen Natur,
welche so innerlich tief und reich begabt ist, daß sie jeder Form ihr Wesen
einzuprägen weiß, indem sie diese von innen neu umbildet und dadurch von
der Nötigung zu ihrem äußerlichen Umsturz bewahrt wird. So ist der
Deutsche nicht revolutionär, sondern reformatorisch, und so erhält er sich
endlich auch für die Kundgebung seines inneren Wesens einen Reichtum von
Formen, wie keine andere Nation. Dieser tiefinnere Quell scheint eben dem
Franzosen versiegt zu sein, weshalb er, durch die äußere Form seiner Zustände
im Staat wie in der Kunst beängstigt, sich sofort zu ihrer gänzlichen
Zerstörung wenden zu müssen glaubt, gewissermaßen in der Annahme, die neue
behaglichere Form müsse dann ganz von selbst sich bilden lassen. So geht
seine Auflehnung sonderbarerweise immer nur gegen sein eigenes Naturell,
welches sich nicht tiefer zeigt, als es in jener beängstigenden Form sich
bereits ausspricht. Dagegen hat es der Entwickelung des deutschen Geistes
nichts geschadet, daß unsere poetische Literatur des Mittelalters sich aus der
Übertragung französischer Rittergedichte ernährte: die innere Tiefe eines
Wolfram von Eschenbach bildete aus demselben Stoffe, der in der Urform uns als
bloßes Kuriosum aufbewahrt ist, ewige Typen der Poesie. So nahmen wir die
klassische Form der römischen und griechischen Kultur zu uns auf, bildeten ihre
Sprache, ihre Verse nach, wußten uns die antike Anschauung anzueignen, aber nur
indem wir unseren eigenen innersten Geist in ihnen aussprachen. So auch
überkamen wir die Musik mit allen ihren Formen von den Italienern, und was wir
in diese einbildeten, das haben wir nun in den unbegreiflichen Werken des
Beethovenschen Genius vor uns.
Diese Werke selbst erklären zu wollen, würde ein törichtes Unternehmen
sein. Indem wir sie uns ihrer Reihenfolge nach vorführen, haben wir mit
immer gesteigerter Deutlichkeit die Durchdringung der musikalischen Form von
dem Genius der Musik wahrzunehmen. Es ist, als ob wir in den Werken
seiner Vorgänger das gemalte Transparentbild bei Tagesscheine gesehen und hier
in Zeichnung und Farbe ein offenbar mit dem Werke des echten Malers gar nicht
zu vergleichendes, einer durchaus niedrigeren Kunstart angehöriges, deshalb
auch von den rechten Kunstbekennern von oben herab angesehenes Pseudokunstwerk
vor uns gehabt hätten: dieses war zur Ausschmückung von Festen, bei
fürstlichen Tafeln, zur Unterhaltung üppiger Gesellschaften u. dergl.
ausgestellt, und der Virtuos stellte seine Kunstfertigkeit als das zur
Beleuchtung bestimmte Licht davor statt dahinter. Nun aber stellt
Beethoven dieses Bild in das Schweigen der Nacht, zwischen die Welt der
Erscheinung und die tiefinnere des Wesens aller Dinge, aus welcher er jetzt das
Licht des Hellsichtigen hinter das Bild leitet: da lebt denn dieses in
wundervoller Weise vor uns auf, und eine zweite Welt steht vor uns, von der uns
auch das größte Meisterwerk eines Raffael keine Ahnung geben konnte.
Die Macht des Musikers ist hier nicht anders, als durch die Vorstellung
des Zaubers zu fassen. Gewiß ist es ein bezauberter Zustand, in den wir
geraten, wenn wir bei der Anhörung eines echten Beethovenschen Tonwerkes in
allen den Teilen des Musikstückes, in welchen wir bei nüchternen Sinnen nur
eine Art von technischer Zweckmäßigkeit für die Aufstellung der Form erblicken
können, jetzt eine geisterhafte Lebendigkeit, eine bald zartfühlige, bald
erschreckende Regsamkeit, ein pulsierendes Schwingen, Freuen, Sehnen, Bangen,
Klagen und Entzücktsein wahrnehmen, welches alles wiederum nur aus dem tiefsten
Grunde unseres eigenen Inneren sich in Bewegung zu setzen scheint. Denn
das für die Kunstgeschichte so wichtige Moment in dem musikalischen Gestalten
Beethovens ist dieses, daß hier jedes technische Akzidenz der Kunst, durch
welches sich der Künstler zum Zwecke seiner Verständlichkeit in ein
konventionelles Verhalten zu der Welt außer ihm setzt, selbst zur höchsten
Bedeutung als unmittelbarer Erguß erhoben wird. Wie ich mich anderswo
bereits ausdrückte, gibt es hier keine Zutat, keine Einrahmung der Melodie
mehr, sondern alles wird Melodie, jede Stimme der Begleitung, jede rhythmische
Note, ja selbst die Pause.
Da es ganz unmöglich ist, das eigentliche Wesen der Beethovenschen Musik
besprechen zu wollen, ohne sofort in den Ton der Verzückung zu verfallen, und
wir bereits an der leitenden Hand des Philosophen uns über das wahre Wesen der
Musik überhaupt (womit die Beethovensche Musik im besonderen zu verstehen war)
eingehender aufzuklären suchten, so wird, wollen wir von dem Unmöglichen
abstehen, uns zunächst immer wieder der persönliche Beethoven zu fesseln haben,
als der Fokus der Lichtstrahlen der von ihm ausgehenden Wunderwelt. --
Prüfen wir nun, woher Beethoven diese Kraft gewann, oder vielmehr, da
das Geheimnis der Naturbegabung uns verschleiert bleiben muß und wir nur aus
ihrer Wirkung das Vorhandensein dieser Kraft fraglos anzunehmen haben, suchen
wir uns klarzumachen, durch welche Eigentümlichkeit des persönlichen Charakters
und durch welche moralischen Triebe desselben der große Musiker die
Konzentration jener Kraft auf diese eine ungeheuere Wirkung, welche seine
künstlerische Tat ausmacht, ermöglichte. Wir ersahen, daß wir hierfür
jede Annahme einer Vernunfterkenntnis, durch welche die Ausbildung seiner
künstlerischen Triebe etwa geleitet worden wäre, ausschließen müssen.
Dagegen werden wir uns lediglich an die männliche Kraft seines Charakters zu halten
haben, dessen Einfluß auf die Entfaltung des inneren Genius des Meisters wir
zuvor schon alsbald zu berühren hatten.
Wir brachten hier sofort Beethoven mit Haydn und Mozart in
Vergleich. Betrachten wir das Leben dieser beiden, so ergibt sich, wenn
wir diese wieder gegen sich zusammenhalten, ein Übergang von Haydn durch Mozart
zu Beethoven, zunächst in der Richtung der äußeren Bestimmungen des
Lebens. Haydn war und blieb ein fürstlicher Bedienter, der für die
Unterhaltung seines glanzliebenden Herren als Musiker zu sorgen hatte,
temporäre Unterbrechungen, wie seine Besuche in London, änderten im Charakter
der Ausübung seiner Kunst wenig, denn gerade dort auch war er immer nur der
vornehmen Herren empfohlene und von diesen bezahlte Musiker. Submiß und
devot, blieb ihm der Frieden eines wohlwollenden, heiteren Gemütes bis in ein
hohes Alter ungetrübt, nur das Auge, welches uns aus seinem Porträt anblickt,
ist von einer sanften Melancholie erfüllt. -- Mozarts Leben
war dagegen ein unausgesetzter Kampf f0³r eine friedlich gesicherte Existenz,
wie sie gerade ihm so eigentümlich erschwert bleiben sollte. Als Kind von
halb Europa geliebkost, findet er als Jüngling jede Befriedigung seiner lebhaft
erregten Neigung bis zur lästigsten Bedrückung erschwert, um, von dem Eintritte
in das Mannesalter an elend, einem frühen Tode entgegenzusiechen. Ihm
ward sofort der Musikdienst bei einem fürstlichen Herrn unerträglich: er
sucht sich vom Beifalle des größeren Publikums zu ernähren, gibt Konzerte und
Akademien, das flüchtig Gewonnene wird der Lebenslust geopfert. Verlangte
Haydns Fürst steht bereite neue Unterhaltung, so mußte Mozart nicht minder von
Tag zu Tag für etwas Neues sorgen, um das Publikum anzuziehen, Flüchtigkeit in
der Konzeption und in der Ausführung nach angeeigneter Routine, wird ein
Haupterklärungsgrund für den Charakter ihrer Werke. Seine wahrhaft edlen
Meisterwerke schreib Haydn erst als Greis, im Genusse eines auch durch
auswärtigen Ruhm gesicherten Behagens. Nie gelangte aber Mozart zu diesem:
seine schönsten Werke sind zwischen dem Übermute des Augenblickes und der Angst
der nächsten Stunde entworfen. So stand ihm immer nur wieder eine
reichliche fürstliche Bedienstung als ersehnte Vermittlerin eines dem
künstlerischen Produzieren günstigeren Lebens vor der Seele. Was ihm sein
Kaiser vorenthält, bietet ihm ein König von Preußen: er bleibt
"seinem Kaiser treu und verkommt dafür im Elend.
Hätte Beethoven nach kalter Vernunftüberlegung seine Lebenswahl
getroffen, sie hätte ihn im Hinblick auf seine beiden großen Vorgänger nicht
sicherer führen können, als ihn hierbei in Wahrheit der naive Ausdruck seines
angeborenen Charakters bestimmte. Es ist erstaunlich zu sehen, wie hier
alles durch den kräftigen Instinkt der Natur entschieden wurde. Ganz
deutlich spricht dieser in Beethovens Zurückscheuen vor einer Lebenstendenz wie
derjenigen Haydns. Ein Blick auf den jungen Beethoven genügte wohl auch,
um jeden Fürsten von dem Gedanken abzubringen, diesen zu seinem Kapellmeister
zu machen. Merkwürdiger zeigt sich dagegen die Komplexion seiner
Charaktereigentümlichkeiten in denjenigen Zügen desselben, welche ihn vor einem
Schicksale wie dem Mozarts bewahrten. Gleich diesem völlig besitzlos in
einer Welt ausgesetzt, in welcher nur das Nützliche sich lohnt, das Schöne nur
belohnt wird, wenn es dem Genusse schmeichelt, das Erhabene aber durchaus ohne
alle Erwiderung bleiben muß, fand Beethoven zuerst sich davon ausgeschlossen,
durch das Schöne die Welt sich geneigt zu machen. Daß Schönheit und
Weichlichkeit ihm für gleich gelten müßten, drückte seine physiognomische
Konstitution sofort mit hinreißender Prägnanz aus. Die Welt der
Erscheinung hatte einen dürftigen Zugang zu ihm. Sein fast unheimlich
stechendes Auge gewahrte in der Außenwelt nichts wie belästigende Störungen
seiner inneren Welt, welche sich abzuhalten fast seinen einzigen Rapport mit
dieser Welt ausmachte. So wird der Krampf zum Ausdrucke seines Gesichtes,
der Krampf des Trotzes hält diese Nase, diesen Mund in der Spannung, welche nie
zum Lächeln, sondern nur zum ungeheueren Lachen sich lösen kann. Galt es
als physiologisches Axiom für hohe geistige Begabung, daß ein großes Gehirn in
dünner zarter Hirnschale eingeschlossen sein soll, wie zur Erleichterung eines
unmittelbaren Erkennens der Dinge außer uns, so sahen wir dagegen bei der vor
mehreren Jahren stattgefundenen Besichtigung der Überreste des Toten, in
Übereinstimmung mit einer außerordentlichen Stärke des ganzen Knochenbaues, die
Hirnschale von ganz ungewöhnlicher Dicke und Festigkeit. So schützte die
Natur in ihm ein Gehirn von übermäßiger Zartheit, damit es nur nach innen
blicken und die Weltschau eines großen Herzens in ungestörter Ruhe üben
könnte. Was diese furchtbar rüstige Kraft umschloß und bewahrte, war eine
innere Welt von so lichter Zartheit, da0_ sie, schutzlos der rohen Betastung
der Außenwelt preisgegeben, weich zerflossen und verduftet wäre -- wie der
zarte Licht- und Liebesgenius Mozarts. --
Nun sage man sich, wie ein solches Wesen aus solch wuchtigem Gehäuse in
die Welt blickte! -- Gewiß konnten die inneren Willensaffekte dieses Menschen
nie oder nur undeutlich seine Auffassung der Außenwelt bestimmen, sie waren zu
heftig und zugleich zu zart, um an einer der Erscheinungen haften zu können,
welche sein Blick nur mit scheuer Hast, endlich mit jenem Mißtrauen des stets
Unbefriedigten streifte. Hier fesselte ihn selbst nichts mit der
flüchtigen Täuschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach
äußerem Genusse herauslocken konnte. Ein kindisches Behagen an den
Zerstreuungen einer lebenslustigen großen Stadt konnte Beethoven kaum nur
berühren, denn seine Willenstriebe waren viel zu stark, um in solch
oberflächlich buntem Treiben auch nur die mindeste Sättigung finden zu
können. Nährte sich hieraus namentlich seine Neigung zur Einsamkeit, so
fiel diese wieder mit seiner Bestimmung zur Unabhängigkeit zusammen. Ein
bewundernswert sicherer Instinkt leitete ihn gerade hierin und ward zur
hauptsächlichsten Triebfeder der Äußerungen seines Charakters. Keine
Vernunfterkenntnis hätte ihn dabei deutlicher anweisen können, als dieser
unabweisliche Trieb seines Instinktes. Was Spinozas Bewußtsein leitete,
sich durch Gläserschleifen zu ernähren, was unseren Schopenhauer mit der sein
ganzes äußeres Leben, ja unerklärliche Züge seines Charakters bestimmenden
Sorge, sein kleines Erbvermögen sich ungeschmälert zu erhalten, erfüllte,
nämlich die Einsicht, daß die Wahrhaftigkeit jeder philosophischen Forschung
durch eine Abhängigkeit von der Nötigung zum Gelderwerb auf dem Wege
wissenschaftlicher Arbeiten ernstlich gefährdet ist: dasselbe bestimmte
Beethoven in seinem Trotze gegen die Welt, in seinem Hange zur Einsamkeit wie
in den fast rauhen Neigungen, die sich bei der Wahl seiner Lebensweise
aussprachen.
Wirklich hatte sich auch Beethoven durch den Ertrag seiner musikalischen
Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wenn ihn nun aber nichts
reizte, seiner Lebensweise ein anmutiges Behagen zu sichern, so ergab sich ihm
hieraus eine mindere Nötigung sowohl zum schnellen, oberflächlichen Arbeiten,
als auch zu Zugeständnissen an einen Geschmack, dem nur durch das Gefällige
beizukommen war. Je mehr er so den Zusammenhang mit der Außenwelt verlor, desto
klarsichtiger wendete sich sein Blick seiner inneren Welt zu. Je vertrauter
er sich hier in der Verwaltung seines inneren Reichtums fühlt, desto bewußter
stellt er nun seine Forderungen nach außen und verlangt von seinen Gönnern
wirklich, daß sie ihm nicht mehr seine Arbeiten bezahlen, sondern dafür sorgen
sollen, daß er überhaupt, unbekümmert um alle Welt, für sich arbeiten
könne. Wirklich geschah es zum ersten Male im Leben eines Musikers, daß
einige wohlwollende Hochgestellte sich dazu verpflichteten, Beethoven in dem
verlangten Sinne unabhängig zu erhalten. An einem ähnlichen Wendepunkte
seines Lebens angelangt, war Mozart, zu früh erschöpft, zugrunde
gegangen. Die große ihm erwiesene Wohltat, wenn sie sich auch nicht in
ununterbrochener Dauer und ungeschmälert erhielt, begründete doch die
eigentümliche Harmonie, die sich in des Meisters, wenn auch noch so seltsam
gestalteten Leben fortan kundtat. Er fühlte sich als Sieger und wußte,
daß er der Welt nur als freier Mann anzugehören habe. Diese mußte sich
ihn gefallen lassen, wie er war. Seine hochadeligen Gönner behandelte er
als Despot, und nichts war von ihm zu erhalten, als wozu und wann er Lust
hatte.
Aber nie und zu nichts hatte er Lust, als was ihn nun immer und einzig
einnahm: das Spiel des Zauberers mit den Gestaltungen seiner inneren
Welt. Denn die äußere erlosch ihm nun ganz, nicht etwa weil Erblindung
ihn ihres Anblickes beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre
fernehielt. Das Gehör war das einzige Organ, durch welches die äußere
Welt noch störend zu ihm drang: für sein Auge war sie längst
erstorben. Was sah der entzückte Träumer, wenn er durch die
buntdurchwimmelten Straßen Wiens wandelte und offenen Auges vor sich
hinstarrte, einzig vom Wachen seiner inneren Tonwelt belebt? -- Das
Entstehen und Zunehmen seines Gehörleidens peinigte ihn furchtbar und stimmte
ihn zu tiefer Melancholie, über die eingetretene völlige Taubheit, namentlich
über den Verlust der Fähigkeit, musikalischen Vorträgen zu lauschen, vernehmen
wir keine erheblichen Klagen von ihm, nur der Lebensverkehr war ihm erschwert,
der an sich keinen Reiz für ihn hatte und dem er nun immer entschiedener
auswich.
Ein gehörloser Musiker! -- Ist ein erblindeter Maler zu denken?
Aber den erblindeten Seher kennen wir. Dem Teiresias, dem
die Welt der Erscheinung sich verschlossen und der dafür nun mit dem inneren
Auge den Grund aller Erscheinung gewahrt -- ihm gleicht jetzt der ertäubte
Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens nun einzig noch den Harmonien
seines Inneren lauscht, aus seiner Tiefe nur einzig noch zu jener Welt spricht,
die ihm -- nichts mehr zu sagen hat. So ist der Genius von jedem
Außer-sich befreit, ganz bei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit
dem Blicke des Teiresias gesehen hätte, welches Wunder müßte sich dem
erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt -- das An-sich der
Welt als wandelnder Mensch! --
Und nun erleuchtete sich des Meisters Auge von innen. Jetzt warf
er den Blick auch auf die Erscheinung, die durch sein inneres Licht beschienen,
in wundervollem Reflexe sich wieder seinem Inneren mitteilte. Jetzt
spricht wiederum nur das Wesen der Dinge zu ihm und zeigt ihm diese in dem
ruhigen Lichte der Schönheit. Jetzt versteht er den Wald, den Bach, die
Wiese, den blauen Äther, die heitere Menge, das liebende Paar, den Gesang der
Vögel, den Zug der Wolken, das Brausen des Sturmes, die Wonne der selig
bewegten Ruhe. Da durchdringt all sein Sehen und Gestalten diese
wunderbare Heiterkeit, die erst durch ihn der Musik zu eigen geworden
ist. Selbst die Klage, so innig ureigen allem Tönen, beschwichtigt sich
zum Lächeln: die Welt gewinnt ihre Kindesunschuld wieder. "Mit mir
seit heute im Paradies" -- wer hörte sich dieses Erlöserwort nicht
zugerufen, wenn er der "Pastoral-Symphonie" lauschte?
Jetzt wächst diese Kraft des Gestaltens des Unbegreiflichen,
Niegesehenen, Nieerfahrenen, welches durch sie aber zur unmittelbarsten
Erfahrung von ersichtlicher Begreiflichkeit wird. Die Freude an der
Ausübung dieser Kraft wird zum Humor: aller Schmerz des Daseins bricht sich
an diesem ungeheueren behagen des Spieles mit ihm, der Weltenschöpfer Brahma
lacht über sich selbst, da er die Täuschung über sich selbst erkennt, die
wiedergewonnene Unschuld spielt scherzend mit dem Stachel der gesühnten Schuld,
das befreite Gewissen neckt sich mit seiner ausgestandenen Qual.
Nie hat eine Kunst der Welt etwas so Heiteres geschaffen, als diese
Symphonien in A-Dur und F-dur, mit allen ihnen so innig verwandten Tonwerken
des Meisters aus dieser göttlichen Zeit seiner völligen Taubheit. Die
Wirkung hiervon auf den Hörer ist eben diese Befreiung von aller Schuld, wie
die Nachwirkung das Gefühl des verscherzten Paradieses ist, mit welchem wir uns
wieder der Welt der Erscheinung zukehren. So predigen diese wundervollen
Werke Reue und Buße im tiefsten Sinne einer göttlichen Offenbarung.
Hier ist einzig der ästhetische Begriff des Erhabenen anzuwenden:
denn eben die Wirkung des Heiteren geht hier sofort über alle Befriedigung
durch das Schöne weit hinaus. Jeder Trotz der erkenntnisstolzen Vernunft
bricht sich hier sofort an dem Zauber der Überwältigung unserer ganzen Natur;
die Erkenntnis flieht mit dem Bekenntnis ihres Irrtumes, und die ungeheure
Freude dieses Bekenntnisses ist es, in welcher wir aus tiefster Seele
aufjauchzen, so ernsthaft auch die gänzlich gefesselte Miene des Zuhörers sein
Erstaunen über die Unfähigkeit unseres Sehens und Denkens gegenüber dieser
wahrhaftigsten Welt uns verrät. --
Was konnte von dem menschlichen Wesen des weltentrückten Genius der
Beachtung der Welt noch übrig bleiben? Was konnte das Auge des
begegnenden Weltmenschen an ihm noch gewahren? Gewiß nur
Mißverständliches, wie er selbst nur durch Mißverständnis mit dieser Welt
verkehrte, über welche er, vermöge seiner naiven Großherzigkeit, in einem
steten Widerspruche mit sich selbst lag, der immer nur wieder auf dem
erhabensten Boden der Kunst sich harmonisch ausgleichen konnte. Denn soweit
seine Vernunft die Welt zu begreifen suchte, fühlte sein Gemüt sich zunächst
durch die Ansichten des Optimismus beruhigt, wie er in den schwärmerischen
Humanitätstendenzen des vorigen Jahrhunderts zu einer Gemeinannahme der
bürgerlich-religiösen Welt ausgebildet worden war. Jeden gemütlichen
Zweifel, der ihm aus den Erfahrungen des Lebens gegen die Richtigkeit dieser
Lehre aufstieß, bekämpfte er mit ostensibler Dokumentierung religiöser
Grundmaximen. Sein Innerstes sagte ihm: die Liebe ist Gott, und so
dekretierte er auch: Gott ist die Liebe. Nur was mit Emphase an
diese Dogmen anstreifte, erhielt aus unseren Dichtern seinen Beifall, fesselte
ihn der "Faust" stets gewaltig, so war ihm Klopstock und mancher
flachere Humanitätssänger doch eigentlich besonders ehrwürdig. Seine
Moral war von strengster bürgerlicher Ausschließlichkeit, eine frivole Stimmung
brachte ihn zum Schäumen. Gewiß bot er so selbst dem aufmerksamsten
Umgange keinen einzigen Zug von Geistreichigkeit dar, und Goethe mag, trotz
Bettinas seelenvollen Phantasien über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit
ihm wohl seine herzliche Not gehabt haben. Aber wie er, ohne alles
Bedürfnis des Luxus, sparsam, ja oft bis zur Geizigkeit sorgsam sein Einkommen
bewachte, so drückt sich, wie in diesem Zuge, auch in seiner streng religiösen
Moralität der sicherste Instinkt aus, durch dessen Kraft er sein Edelstes, die
Freiheit seines Genius, gegen die unterjochende Beeinflussung der ihn
umgebenden Welt bewahrte.
Er lebte in Wien und kannte nur Wien: dies sagt genug.
Der Östreicher, der nach der Ausrottung jeder Spur des deutschen
Protestantismus in der Schule romanischer Jesuiten auferzogen worden war, hatte
selbst den richtigen Akzent für seine Sprache verloren, welche ihm jetzt, wie
die klassischen Namen der antiken Welt, nur noch in undeutscher Verwelschung
vorgesprochen wurde. Deutscher Geist, deutsche Art und Sitte wurden ihm aus
Lehrbüchern spanischer und italienischer Abkunft erklärt, auf dem Boden einer
gefälschten Geschichte, einer gefälschten Wissenschaft, einer gefälschten
Religion war eine von der Natur heiter und frohmutig angelegte Bevölkerung zu
jenem Skeptizismus erzogen worden, welcher, da vor allem das Haften am Wahren,
Echten und Freien untergraben werden sollte, als wirkliche Frivolität sich zu
erkennen geben mußte.
Dies war nun derselbe Geist, der auch der einzigen in Östreich
gepflegten Kunst, der Musik, die Ausbildung und in Wahrheit erniedrigende
Tendenz zugeführt hatte, welcher wir zuvor bereits unser Urteil zuwendeten. Wir
sahen, wie Beethoven durch die mächtige Anlage seiner Natur sich gegen diese
Tendenz wahrte, und erkennen nun die ganz gleiche Kraft in ihm auch mächtig zur
Abwehr einer frivolen Lebens- und Geistestendenz wirken. Katholisch getauft und
erzogen, legte durch solche Gesinnung der ganze Geist des deutschen
Protestantismus in ihm. Und dieser leitete ihn auch als Künstler wiederum auf
dem Wege, auf welchem er auf den einzigen Genossen seiner Kunst treffen sollte,
dem er ehrfurchtsvoll sich neigen, den er als Offenbarung des tiefsten
Geheimnisses seiner eigenen Natur in sich aufnehmen konnte. Galt Haydn als der
Lehrer des Jünglings, so ward der große Sebastian Bach für das mächtig
sich entfaltende Kunstleben des Mannes sein Führer.
Bachs Wunderwerk ward ihm zur Bibel seines Glaubens, in ihm las er und
vergaß darüber die Welt des Klanges, die er nun nicht mehr vernahm. Da stand es
geschrieben, das Rätselwort seines tiefinnersten Traumes, das einst der arme
Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt aufgeschrieben
hatte. Das waren dieselben rätselhaft verschlungenen Linien und wunderbar
krausen Zeichen, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Geheimnis der
vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das
Zauberbuch des Nekromanten, der das Licht des Makrokosmos über den Mikrokosmos
hinleuchten lä3t. Was nur das Auge des deutschen Geistes erschauen, nur sein
Ohr vernehmen konnte, was ihn aus innerstem Gewahrwerden zu der
unwiderstehlichen Protestation gegen alles ihm auferlegte äußere Wesen trieb,
das las nun Beethoven klar und deutlich in seinem allerheiligsten Buche und --
ward selbst ein Heiliger. --
Wie aber konnte gerade dieser Heilige wiederum für das Leben sich zu
seiner eigenen Heiligkeit verhalten, da er wohl erleuchtet war, "die
tiefste Weisheit auszusprechen, aber in einer Sprache, welche seine Vernunft
nicht verstand?" Mute nicht sein Verkehr mit der Welt nur den Zustand des
aus tiefstem Schlafe Erwachten ausdrücken, der auf den beseligenden Traum
seines Inneren sich zu erinnern beschwerlich sich abmüht? Einen ähnlichen
Zustand dürfen wir bei dem religiösen Heiligen annehmen, wenn er, vom
unerläßlichesten Lebensbedürfnisse angetrieben, sich in irgendwelcher
Annäherung den Verrichtungen des gemeinen Lebens wieder zuwendet: nur da dieser
in der Not des Lebens selbst deutlich die Sühne für ein sündiges Dasein erkennt
und in deren geduldiger Ertragung sogar mit Begeisterung das Mittel der
Erlösung ergreift, wogegen jener heilige Seher seine Daseinsschuld eben nur als
Leidender abträgt. Der Irrtum des Optimisten rächt sich nun durch Verstärkung
dieser Leiden und seiner Empfindlichkeit dagegen. Jede ihm begegnende Gefühllosigkeit,
jeder Zug von Selbstsucht oder Härte, den er stets und immer wieder wahrnimmt,
empört ihn als eine unbegreifliche Verderbnis der mit religiösem Glauben in
seiner Annahme festgehaltenen, ursprünglichen Güte des Menschen. So fällt er
aus dem Paradiese seiner inneren Harmonie immer in die Hölle des furchtbar
disharmonischen Daseins zurück, welches er wiederum nur als Künstler endlich
harmonisch sich aufzulösen weiß.
Wollen wir uns das Bild eines Lebenstages unseres Heiligen vorführen, so
dürfte eines jener wunderbaren Tonst0ücke des Meisters selbst uns das beste
Gegenbild dazu an die Hand geben, wobei wir, um uns selbst nicht zu täuschen,
immer nur das Verfahren festhalten müßten, mit welchem wir das Phänomen des
Traumes analogisch, nicht aber mit diesem es identifizierend, auf die
Entstehung der Musik als Kunst anwendeten. Ich wähle also, um solch einen echt
Beethovenschen Lebenstag aus seinen innersten Vorgängen uns damit zu
verdeutlichen, das große Cis-Moll-Quartett, weil wir dann jeden
bestimmten Vergleich sofort fahren zu lassen uns genötigt fühlen und nur die
unmittelbare Offenbarung aus einer anderen Welt vernehmen, ermöglicht sich uns
aber doch wohl bis zu einem gewissen Grade, wenn wir diese Tondichtung uns bloß
in der Erinnerung vorführen. Selbst hierbei muß ich aber wiederum der Phantasie
des Lesers allein es überlassen, das Bild in seinen näheren einzelnen Zügen
selbst zu beleben, weshalb ich ihr nur mit einem ganz allgemeinen Schema zu
Hilfe komme.
Das einleitende längere Adagio, wohl das Schermütigste, was je in Tönen
ausgesagt worden ist, möchte ich mit dem Erwachen am Morgen des Tages
bezeichnen, "der in seinem langen Lauf nicht einen Wunsch erfüllen soll,
nicht einen!" Doch zugleich ist es ein Bußgebet, eine Beratung mit Gott im
Glauben an das ewig Gute. -- Das nach innen gewendete Auge erblickt da auch die
nur ihm erkenntliche tröstliche Erscheinung (Allegro 6/8), in welcher das
Verlangen zum wehmütig holden Spiele mit sich selbst wird; das innerste
Traumbild wird in einer lieblichsten Erinnerung wach. Und nun ist es, als ob
(mit dem überleitenden kurzen Allegro moderato) der Meister, seiner Kunst
bewußt, sich zu seiner Zauberarbeit zurechtsetzte, die wiederbelebte Kraft
dieses ihm eigenen Zaubers übte er nun (Andante 2/4) an dem Festbannen einer
anmutsvollen Gestalt, um an ihr, dem seligen Zeugnisse innigster Unschuld, in
stets neuer, unerhörter Veränderung durch die Strahlenbrechungen des ewigen
Lichtes, welches er darauf fallen läßt, sich rastlos zu entzücken. -- Wir
glauben nun den tief aus sich Beglückten den unsäglich erheiterten Blick auf
die Außenwelt richten zu sehen (Presto 2/2): da steht sie wieder vor ihm, wie
in der Pastoralsymphonie, alles wird ihm von seinem inneren Glücke beleuchtet,
es ist, als lausche er den eigenen Tönen der Erscheinungen, die lustig und
wiederum derb, im rhythmischen Tanze sich vor ihm bewegen. Er schaut dem Leben
zu und scheint sich (kurzes Adagio 3/4) zu besinnen, wie er es anfinge, diesem
Leben selbst zum Tanze aufzuspielen: ein kurzes, aber trübes Nachsinnen, als
versenke er sich in den tiefen Traum seiner Seele. Ein Blick hat ihm wieder das
Innere der Welt gezeigt: er erwacht und streicht nun in die Saiten zu einem
Tanz aufspiele, wie es die Welt noch nie gehört (Allegro finale). Das ist der
Tanz der Welt selbst: wilde Lust, schmerzliche Klage, Liebesentzücken, höchste
Wonne, Jammer, Rasen, Wollust und Leid, da zuckt es wie Blitze, Wetter grollen:
und über allem der ungeheuere Spielmann, der alles zwingt und bannt, stolz und
sicher vom Wirbel zum Strudel, zum Abgrund geleitet: -- er lächelt über sich
selbst, da ihm dieses Zaubern doch nur ein Spiel war. -- So winkt ihm die
Nacht. Sein Tag ist vollbracht. --
Es ist nicht möglich, den Menschen Beethoven für irgendeine Betrachtung
festzuhalten, ohne sofort wieder den wunderbaren Musiker Beethoven zu seiner
Erklärung heranzuziehen.
Wir ersahen, wie seine instinktive Lebenstendenz mit der Tendenz der
Emanzipation seiner Kunst zusammenfiel, wie er selbst kein Diener des Luxus
sein konnte, so mußte auch seine Musik von allen Merkmalen der Unterordnung
unter einen frivolen Geschmack befreit werden. Wie des weiteren und wiederum
sein religiös optimistischer Glaube Hand in Hand mit einer instinktiven Tendenz
der Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging, davon haben wir ein Zeugnis von
erhabenster Naivität in seiner neunten Symphonie mit Chören, deren
Genesis wir hier näher betrachten müssen, um uns den wundervollen Zusammenhang
der bezeichneten Grundtendenzen der Natur unseres Heiligen klarzumachen. --
Derselbe Trieb, der Beethovens Vernunfterkenntnis leitete, den guten
Menschen sich zu konstruieren, führte ihn in der Herstellung der Melodie
dieses guten Menschen. Der Melodie, welche unter der Verwendung der
Kunstmusiker ihre Unschuld verloren hatte, wollte er diese reinste Unschuld
wiedergeben. Man rufe sich die italienische Opernmelodie des vorigen
Jahrhunderts zurück, um zu erkennen, welch gänzlich nur der Mode und ihren
Zwecken dienendes Wesen dieses sonderbar nichtige Tongespenst war: durch sie
und ihre Verwendung war eben die Musik so tief erniedrigt worden, daß der
lüsterne Geschmack von ihr immer nur etwas Neues verlangte, weil die Melodie
von gestern heute nicht mehr anzuhören war. Von dieser Melodie lebte aber auch
zunächst unsere Instrumentalmusik, deren Verwendung für die Zwecke eines
keineswegs edlen gesellschaftlichen Lebens wir oben uns bereits vorführten.
Hier war es nun Haydn, der alsbald zur derben und gemütlichen
Volkstanzweise griff, die er oft leicht erkenntlich selbst den ihm zunächst
liegenden ungarischen Bauerntänzen entnahm, er blieb hiermit in einer niederen,
vom engeren Lokalcharakter stark bestimmten Sphäre. Aus welcher Sphäre war nun
aber diese Naturmelodie zu entnehmen, wenn sie einen edleren, ewigen Charakter
tragen sollte? Denn auch diese Haydnsche Bauerntanzweise fesselte mehr als
pikante Sonderbarkeit, keineswegs aber als für alle Zeiten gültiger, rein
menschlicher Kunsttypus. Unmögliche war sie aber aus den höheren Sphären der
Gesellschaft zu entnehmen, denn dort eben herrschte die verzärtelte,
verschnörkelte, von jeder Schuld behaftete Melodie des Opernsängers und
Balletttänzers. Auch Beethoven ging Haydns Weg, nur verwendete er die
Volkstanzweise nicht mehr zur Unterhaltung an einer fürstlichen Speisetafel,
sondern er spielte sie in einem idealen Sinne dem Volke selbst auf. Bald ist es
eine schottische, bald eine russische, eine altfranzösische Volksweise, in
welcher er den erträumten Adel der Unschuld erkannte und der er huldigend seine
ganze Kunst zu Füßen legte. Mit einem ungarischen Bauerntanze spielte er (im
Schlußsatze seiner A-Dur-Symphonie) aber der ganzen Natur auf, so daß, wer
diese darnach tanzen sehen könnte, im ungeheueren Kreiswirbel einen neuen
Planeten vor seinen Augen entstehen zu sehen glauben müßte.
Aber es galt den Urtypus der Unschuld, den idealen "guten
Menschen" seines Glaubens zu finden, um ihn mit seinem "Gott ist die
Liebe" zu vermählen. Fast könnte man den Meister schon in seiner
"Sinfonia eroica" auf dieser Spur erkennen: das ungemein einfache
Thema des letzten Satzes derselben, welches er zu Verarbeitungen auch anderswo
wieder benützte, schien im als Grundgerüste hierzu dienen zu sollen, was er an
ihm von hinreißendem Melos aufbaut, gehört aber noch zu sehr dem von ihm so
eigentümlich entwickelten und erweiterten, sentimentalen Mozartschen Cantabile
an, um als eine Errungenschaft in dem von uns gemeinten Sinne zu gelten. --
Deutlicher zeigt sich die Spur in dem jubelreichen Schlußsatze der
C-Moll-Symphonie, wo uns die einfache, fast nur auf Tonika und Dominante, in
der Naturskala der Hörner und Trompeten daherschreitende Marschweise um so mehr
durch ihre große Naivität anspricht, als die vorangehende Symphonie jetzt nur
wie eine spannende Vorbereitung auf sie erschein, wie das bald vom Sturm, bald
von zarten Windeswehen bewegte Gewölk, aus welchem nun die Sonne mit mächtigen
Strahlen hervorbricht.
Zugleich (wir schalten hier diese scheinbare Abschweifung als von
wichtigem Bezug auf den Gegenstand unserer Untersuchung ein) fesselt uns aber
diese C-Moll-Symphonie als eine der selteneren Konzeptionen des Meisters, in
welchen schmerzlich erregte Leidenschaftlichkeit, als anfänglicher Grundton,
auf der Stufenleiter des Trostes, der Erhebung, bis zum Ausbruche
siegesbewußter Freude sich aufschwingt. Hier betritt das lyrische Pathos fast
schon den Boden einer idealen Dramatik im bestimmteren Sinne, und wie es
zweifelhaft dünken dürfte, ob auf diesem Wege die musikalische Konzeption nicht
bereits in ihrer Reinheit getrübt werden möchte, weil die zur Herbeiziehung von
Vorstellungen verleiten müßte, welche an sich dem Geiste der Musik durchaus
fremd erscheiden, so ist andererseits wiederum nicht zu verkennen, daß der
Meister keineswegs durch eine abirrende ästhetische Spekulation, sondern
lediglich durch einen dem eigensten Gebiete der Musik entkeimten, durchaus
idealen Instinkt hierin geleitet wurde. Dieser fiel, wie wir dis am
Ausgangspunkte dieser letzten Untersuchung zeigten, mit dem Bestreben zusammen,
den Glauben an die ursprüngliche Güte der menschlichen Natur gegen alle, dem
bloßen Anschein zuzuweisenden Einsprüche der Lebenserfahrung für das Bewußtsein
zu retten oder vielleicht auch wiederzugewinnen. Die fast durchgängig dem
Geiste der erhabensten Heiterkeit entsprungenen Konzeptionen des Meisters
gehörten, wie wir dies oben ersahen, vorzüglich der Periode jener seligen
Vereinsamung an, welche nach dem Eintritte seiner völligen Taubheit ihn der
Welt des Leidens gänzlich entrückt zu haben schien. Vielleicht haben wir nun
nicht nötig, auf die wiederum eintretende schmerzlichere Stimmung in einzelnen
wichtigsten Konzeptionen Beethovens die Annahme des Verfalles jener inneren
Heiterkeit zu gründen, da wir ganz gewiß fehlen würden, wenn wir glauben
wollten, der Künstler könne überhaupt anders als bei tiefinnerer Seelenheiterkeit
konzipieren. Die in der Konzeption sich ausdrückende Stimmung muß daher der
Idee der Welt selbst angehören, welche der Künstler erfaßt und im Kunstwerke
verdeutlicht. Da wir nun aber mit Bestimmtheit annahmen, daß in der Musik sich
selbst die Idee der Welt offenbare, so ist der konzipierende Musiker vor allem
in dieser Idee mit enthalten, und was er ausspricht, ist nicht seine Ansicht
von der Welt, sondern die Welt selbst, in welcher Schmerz und Freude, Wohl und
Wehe wechseln. Auch der bewußte Zweifel des Menschen Beethoven war in
dieser Welt enthalten, und so spricht er unmittelbar, keineswegs als Objekt der
Reflexion aus ihm, wenn er und die Welt etwa so zum Ausdruck bringt, wie in
seiner neunten Symphonie, deren erster Satz uns allerdings die Idee der Welt in
ihrem grauenvollsten Lichte zeigt. Unverkennbar waltet aber andererseits gerade
in diesem Werke der überlegt ordnende Wille seines Schöpfers, wir begegnen
seinem Ausdrucke unmittelbar, als er dem Rasen der nach jeder Beschwichtigung
immer wiederkehrenden Verzweiflung, wie mit dem Angstrufe des aus furchtbarem
Traume Erwachenden das wirklich gesprochene Wort zuruft, dessen idealer Sinn
kein anderer ist, als: "der Mensch ist doch gut!"
Von je hat es nicht nur der Kritik, sondern auch dem unbefangenen
Gefühle Anstoß gegeben, den Meister hier plötzlich aus der Musik gewissermaßen
herausfallen, gleichsam aus dem von ihm selbst gezogenen Zauberkreise
heraustreten zu sehen, um somit an ein von der musikalischen Konzeption völlig
verschiedenes Vorstellungsvermögen zu appellieren. In Wahrheit gleicht dieser
unerhörte künstlerische Vorgang dem jähen Erwachen aus dem Traume, wir
empfinden aber zugleich die wohltätige Einwirkung hiervon auf den durch den
Traum auf das äußerste Geängstigten, denn nie hatte zuvor uns ein Musiker die
Qual der Welt so grauenvoll endlos erleben lassen. So war es denn wirklich ein
Verzweiflungssprung, mit dem der göttlich-naive, nur von seinem Zauber erfüllte
Meister in die neue Lichtwelt eintrat, aus deren Boden ihm die lange gesuchte
göttlich-süße, unschuldsreine Menschenmelodie entgegenblühte.
Auch mit dem soeben bezeichneten ordnenden Willen der ihn zu dieser
Melodie führte, sehen wir somit den Meister unentwegt in der Musik, als der
Idee der Welt, enthalten; denn in Wahrheit ist es nicht der Sinn des Wortes,
welcher uns beim Eintritte der menschlichen Stimme einnimmt, sondern der
Charakter dieser menschlichen Stimme selbst. Auch die in Schillers Versen
ausgesprochenen Gedanken sind es nicht, welche uns fortan beschäftigen, sondern
der trauliche Klang des Chorgesanges, an welchem wir selbst einzustimmen uns
aufgefordert fühlen, um, wie in den großen Passionsmusiken S. Bachs es wirklich
mit dem Eintritte des Choral es geschah, als Gemeinde an dem idealen
Gottesdienste selbst mit teilzunehmen. Ganz ersichtlich ist es, daß namentlich
der eigentlichen Hauptmelodie die Worte Schillers, sogar mit wenigem Geschicke
notdürftig erst untergelegt sind, denn ganz für sich, nur von Instrumenten
vorgetragen, hat diese Melodie zuerst sich in voller Breite vor uns entwickelt
und uns dort mit der namentlichen Rührung der Freude an dem gewonnenen
Paradiese erfüllt.
Nie hat die höchste Kunst etwas künstlerisch Einfacheres hervorgebracht
als diese Weise, deren kindliche Unschuld, wenn wir zuerst das Thema im
gleichförmigsten Flüstern von den Baßinstrumenten des Saitenorchesters im
Unisono vernehmen, uns wie mit heiligen Schauern anweht. Sie wird nun der
Cantus firmus, der Choral der neuen Gemeinde, um welchen, wie um den
Kirchenchoral S. Bachs, die hinzutretenden harmonischen Stimmen sich
kontrapunktisch gruppieren: nichts gleicht der holden Innigkeit, zu welcher
jede neu hinzutretende Stimme diese Urweise reinster Unschuld belegt, bis jeder
Schmuck, jede Pracht der gesteigerten Empfindung an ihr und in ihr sich
vereinigt, wie die atmende Welt um ein endlich geoffenbartes Dogma reinster
Liebe. --
Überblicken wir den kunstgeschichtlichen Fortschritt, welchen die Musik
durch Beethoven getan hat, so können wir ihn bündig als gen Gewinn einer
Fähigkeit bezeichnen, welche man ihr vorher absprechen zu müssen vermeinte: sie
ist vermöge dieser Befähigung weit über das Gebiet des ästhetisch Schönen in
die Sphäre des durchaus Erhabenen getreten, in welcher sie von jeder Beengung
durch traditionelle oder konventionelle Formen vermöge vollster Durchdringung
und Belebung dieser Formen mit dem eigensten Geiste der Musik befreit ist. Und
dieser Gewinn zeigt sich sofort für jedes menschliche Gemüt durch den der
Hauptform aller Musik, der Melodie, von Beethoven verliehenen Charakter,
als welcher jetzt die höchste Natureinfachheit wiedergewonnen ist, als der
Born, aus welchem die Melodie zu jeder Zeit und bei jedem Bedürfnisse sich
erneuert und bis zur höchsten, reichsten Mannigfaltigkeit sich ernährt. Und
dieses dürfen wir unter dem einen, allen verständlichen Begriff fassen: die
Melodie ist durch Beethoven von dem Einflusse der Mode und des wechselnden
Geschmackes emanzipiert, zum ewig gültigen, rein menschlichen Typus erhoben
worden. Beethovens Musik wird zu jeder Zeit verstanden werden, während die
Musik seiner Vorgänger größtenteils nur unter Vermittelung kunstgeschichtlicher
Reflexion uns verständlich bleiben wird. --
Aber noch ein anderer Fortschritt wird auf dem Wege, auf welchem
Beethoven die entscheidend wichtige Veredelung der Melodie erzielte,
ersichtlich, nämlich die neue Bedeutung, welche jetzt die Vokalmusik in
ihrem Verhältnisse zur reinen Instrumentalmusik erhält.
Diese Bedeutung war der bisherigen gemischten Vokal- und
Instrumentalmusik fremd. Diese, welche wir bisher zunächst in den kirchlichen
Kompositionen antreffen, dürfen wir fürs erste unbedenklich als eine verdorbene
Vokalmusik ansehen, insofern das Orchester hier nur als Verstärkung oder auch
Begleitung der Gesangstimmen verwendet ist. Des großen S. Bachs Kirchenkompositionen
sind nur durch den Gesangschor zu verstehen, nur daß dieser selbst hier bereits
mit der Freiheit und Beweglichkeit eines Instrumentalorchesters behandelt wird,
welche die Herbeiziehung desselben zur Verstärkung und Unterstützung jenes ganz
von selbst eingab. Dieser Vermischung zur Seite treffen wir dann, bei immer
größerem Verfalle des Geistes der Kirchenmusik, auf die Einmischung des
italienischen Operngesanges mit Begleitung des Orchesters nach den zu
verschiedenen Zeiten beliebten Manieren. Beethovens Genius war es vorbehalten,
den aus diesen Mischungen sich bildenden Kunstkomplex rein im Sinne eines
Orchesters von gesteigerter Fähigkeit zu verwenden. In seiner großen Missa
Solemnis haben wir ein rein symphonisches Werk des echtesten Beethovenschen
Geistes vor uns. Die Gesangstimmen sind hier ganz in dem Sinne wie menschliche
Instrumente behandelt, welchen Schopenhauer diesen sehr richtig auch nur
zugesprochen wissen wollte: der ihnen untergelegte Text wird von uns, gerade in
diesen großen Kirchenkompositionen, nicht seiner begrifflichen Bedeutung nach
aufgefaßt, sondern er dient, im Sinne des musikalischen Kunstwerkes, lediglich
als Material für den Stimmgesang und verhält sich nur deswegen nicht streng zu
unserer musikalisch bestimmten Empfindung, weil er uns keineswegs
Vernunftvorstellungen anregt, sondern, wie dies auch sein kirchlicher Charakter
bedingt, uns nur mit dem Eindrucke wohlbekannter symbolischer Glaubensformeln
berührt.
Durch die Erfahrung, daß eine Musik nichts von ihrem Charakter verliert,
wenn ihr auch sehr verschiedenartige Texte untergelegt werden, erhellt sich
andererseits nun das Verhältnis der Musik zur Dichtkunst als ein
durchaus illusorisches: den es bestätigt sich, daß, wenn zu einer Musik
gesunden wird, nicht der poetische Gedanke, den man namentlich bei Chorgesängen
nicht einmal verständlich artikuliert vernimmt, sondern höchstens das von ihm
aufgefaßt wird, was er im Musiker als Musik und zur Musik anregte. Eine
Vereinigung der Musik und der Dichtkunst muß daher stets zu einer solchen
Geringstellung der letzteren ausschlagen, daß es nur wieder zu verwundern ist,
wenn wir sehen, wie namentlich auch unsere großen deutschen Dichter das Problem
einer Vereinigung der beiden Künste stets von neuem erwogen oder gar
versuchten. Sie wurden hierbei ersichtlich von der Wirkung der Musik in der Oper
geleitet: und allerdings schien hier einzig das Feld zu liegen, auf welchem es
zu einer Lösung des Problems führen mußte. Mögen sich nun die Erwartungen
unserer Dichter einerseits mehr auf die formelle Abgemessenheit ihrer Struktur,
andererseits mehr auf die tief anregende gemütliche Wirkung der Musik bezogen
haben, immer bleibt es ersichtlich, daß es ihnen nur in den Sinn kommen konnte,
der hier dargeboten scheinenden mächtigen Hilfsmittel sich zu bedienen, um der
dichterischen Absicht einen sowohl präziseren, als tiefer dringenden Ausdruck
zu geben. Es mochte sie bedünken, daß die Musik ihnen gern diesen Dienst
leisten würde, wenn sie ihr an der Stelle des trivialen Opernsujets und
Operntextes eine ernstlich gemeinte dichterische Konzeption zuführten. Was sie
immer wieder von ernstlichen Versuchen in dieser Richtung abhielt, mag wohl ein
unklarer, aber richtig geleiteter Zweifel daran gewesen sein, ob die Dichtung
als solche in ihrem Zusammenwirken mit der Musik überhaupt noch beachtet werde.
Bei genauem Besinnen durfte es ihnen nicht entgehen, da in der Oper außer der
Musik uns der szenische Vorgang, nicht aber der ihn erklärende dichterische
Gedanke, die Aufmerksamkeit in Anspruch nahm und da die Oper recht eigentlich
nur das Zuhören oder Zusehen abwechselnd auf sich lenkte. Daß weder für das
eine noch für das andere Rezeptionsvermögen eine vollkommene ästhetische
Befriedigung zu gewinnen war, erklärt sich offenbar daraus, daß, wie ich oben
dies bereits bezeichnete, die Opernmusik nicht zu der der Musik einzig
entsprechenden Andacht umstimmte, in welcher das Gesicht derart depotenziert
wird, daß das Auge die Gegenstände nicht mehr mit der gewohnten Intensität
wahrnimmt, wogegen wir eben finden mußten, da wir hier, von der Musik nur
oberflächlich berührt, durch sie mehr aufgeregt als von ihr erfüllt, nun auch
etwas zu sehen verlangten -- keineswegs aber etwa zu denken, denn
hierfür waren wir, eben durch dieses Widerspiel des Unterhaltungsverlangens,
infolge einer im tiefsten Grunde nur gegen die Langeweile ankämpfenden
Zerstreuung gänzlich der Fähigkeit beraubt worden.
Wir haben uns nun durch die vorangehenden Betrachtungen mit der besonderen
Natur Beethovens genügend vertraut gemacht, um den Meister in seinem Verhalten
zur Oper sofort zu verstehen, wenn er auf das allerentschiedenste ablehnte, je
einen Operntext von frivoler Tendenz komponieren zu wollen. Ballett, Aufzüge,
Feuerwerk, wollüstige Liebesintrigen usw., dazu eine Musik zu machen, das wies
er mit Entsetzen von sich. Seine Musik mute eine ganze, hochherzig
leidenschaftliche Handlung vollständig durchdringen können. Welcher Dichter
sollte ihm hierzu die Hand zu bieten vermögen? Ein einmalig angetretener
Versuch brachte ihn mit einer dramatischen Situation in Berührung, die
wenigstens nichts von der gehaßten Frivolität an sich hatte und außerdem durch
die Verherrlichung der weiblichen Treue dem leitenden Humanitätsdogma des Meisters
gut entsprach. Und doch umschloß dieses Opernsujet so vieles der Musik Fremde,
ihr Unassimilierbare, daß eigentlich nur die große Ouvertüre zu Leonore uns
wirklich deutlich macht, wie Beethoven das Drama verstanden haben wollte. Wer
wird dies hinreißende Tonstück anhören, ohne nicht von der Überzeugung erfüllt
zu werden, daß die Musik auch das vollkommenste Drama in sich schließe? Was ist
die dramatische Handlung des Textes der Oper "Leonore" anderes, als
eine fast widerwärtige Abschwächung des in der Ouvertüre erlebten Dramas, etwa
wie ein langweilig erläuternder Kommentar von Gervinus zu einer Szene des
Shakespeare?
Diese hier jedem Gefühle sich aufdrängende Wahrnehmung kann uns aber zur
vollkommen klaren Erkenntnis werden, wenn wir auf die philosophische Erklärung
der Musik selbst zurückgehen.
Die Musik, welche nicht die in den Erscheinungen der Welt enthaltenen
Ideen darstellt, dagegen selbst eine und zwar eine umfassende Idee der Welt
ist, schließt das Drama ganz von selbst in sich, da das Drama wiederum selbst
die einziger der Musik adäquate Idee der Welt ausdrückt. Das Drama überragt
ganz in der Weise die Schranken der Dichtung, wie die Musik die jeder anderen,
namentlich aber der bildenden Kunst, dadurch, daß seine Wirkung einzig im
Erhabenen liegt. Wie das Drama die menschlichen Charaktere nicht schildert,
sondern diese unmittelbar sich selbst darstellen läßt, so gibt uns eine Musik
in ihren Motiven den Charakter aller Erscheinungen der Welt nach ihrem
innersten An-sich. Die Bewegung, Gestaltung und Veränderung dieser Motive sind
analogisch nicht nur einzig dem Drama verwandt, sondern das die Idee
darstellende Drama kann in Wahrheit einzig nur durch jene so sich
bewegendenden, gestaltenden und sich verändernden Motive der Musik vollkommen
klar verstanden werden. Wir dürften somit nicht irren, wenn wir in der Musik
die aprioristische Befähigung des Menschen zur Gestaltung des Dramas überhaupt
erkennen wollten. Wenn wir die Welt der Erscheinungen uns durch die Anwendung
der Gesetze des Raumes und der Zeit konstruieren, welche in unserem Gehirne
aprioristisch vorgebildet sind, so würde diese wiederum bewußte Darstellung der
Idee der Welt im Drama durch jene inneren Gesetze der Musik vorgebildet sein,
welche im Dramatiker ebenso unbewußt sich geltend machten, wie jene ebenfalls
unbewußt in Anwendung gebrachten Gesetze der Kausalität für die Apperzeption
der Welt der Erscheinungen.
Die Ahnung hiervon war es eben, was unsere großen deutschen Dichter
einnahm, und vielleicht sprachen sie in dieser Ahnung zugleich den
geheimnisvollen Grund der nach anderen Annahmen bestehenden Unerklärlichkeit
Shakespeares aus. Dieser ungeheuere Dramatiker war wirklich nach keiner
Analogie mit irgendwelchem Dichter zu begreifen, weshalb auch ein ästhetisches
Urteil über ihn noch gänzlich unbegründet geblieben ist. Seine Dramen
erscheinen als ein so unmittelbares Abbild der Welt, daß die künstlerische
Vermittelung in der Darstellung der Idee ihnen gar nicht anzumerken und
namentlich nicht kritisch nachzuweisen ist, weshalb sie, als Produkte eines
übermenschlichen Genies angestaunt, unseren großen Dichtern, fast in derselben
Weise wie Naturwunder, zum Studium für das Auffingen der Gesetze ihrer
Erzeugung wurden.
Wie weit Shakespeare über den eigentlichen Dichter erhaben war, drückt
sich bei der ungemeinen Wahrhaftigkeit jedes Zuges seiner Darstellungen oft
schroff genug aus, wenn der Poet, wie z.B. in der Szene des Streites zwischen
Brutus und Cassius (im Julius Cäsar), geradesweges als ein albernes Wesen
behandelt wird, wogegen wir den vermeintlichen "Dichter" Shakespeare
nirgends antreffen als im eigensten Charakter der Gestalten selbst, die in
seinen Dramen sich vor uns bewegen. -- Völlig unvergleichlich blieb daher
Shakespeare, bis der deutsche Genius ein nur im Vergleiche mit ihm analogisch
zu erklärendes Wesen in Beethoven hervorbrachte. -- Fassen wir den Komplex der
Shakespeareschen Gestaltenwelt, mit der ungemeinen Prägnanz der in ihr
enthaltenen und sich berührenden Charaktere, zu einem Gesamteindruck auf unsere
innerste Empfindung zusammen, und halten wir zu diesem den gleichen Komplex der
Beethovenschen Motivenwelt mit ihrer unabwehrbaren Eindringlichkeit und
Bestimmtheit, so müssen wir inne werden, daß die eine dieser Welten die andere
vollkommen deckt, so da jede in der anderen enthalten ist, wenngleich sie in
durchaus verschiedenen Sphären sich zu bewegen scheinen.
Um diese Vorstellung uns zu erleichtern, führen wir uns in der Ouvertüre
zu Coriolan das Beispiel vor, in welchem Beethoven und Shakespeare an dem
gleichen Stoffe sich berühren. Sammeln wir uns in der Erinnerung and den
Eindruck, welchen die Gestalt des Coriolan in Shakespeares Drama auf uns
machte, und halten wir hierbei fürs erste von dem Detail der komplizierten
Handlung nur dasjenige fest, was uns einzig wegen seiner Beziehung zu dem
Hauptcharakter eindrucksvoll verbleiben konnte, so werden wir aus allem Gewirre
die eine Gestalt des trotzigen Coriolan im Konflikt mit seiner innersten Sinne,
welche wiederum aus der eigenen Mutter lauter und eindringlicher zu seinem
Stolze spricht, hervorragen sehen und als dramatische Entwickelung einzig die
Überwältigung des Stolzes durch jene Stimme, die Brechung des Trotzes einer
über das Maß kräftigen Natur festhalten. Beethoven wählt für sein Drama einzig
diese beiden Hauptmotive, welche bestimmter als alle Darlegung durch Begriffe
das innerste Wesen jener beiden Charaktere uns empfinden läßt. Verfolgen wir
nun andächtig die aus der einzigen Entgegenstellung dieser Motive sich
entwickelnde, gänzlich nur ihrem musikalischen Charakter angehörende Bewegung
und lassen wiederum das rein musikalische Detail, welches die Abstufungen,
Berührungen, Entfernungen und Steigerungen dieser Motive in sich schließt, auf
uns wirken, so verfolgen wir zugleich ein Drama, welches in seinem eigentümlichen
Ausdrucke wiederum alles das enthält, was im vorgeführten Werke des
Bühnendichters als komplizierte Handlung und Reibung auch geringerer Charaktere
unsere Teilnahme in Anspruch nahm. Was uns dort als unmittelbar vorgeführte,
von uns fast miterlebte Handlung ergriff, erfassen wir hier als den innersten
Kern dieser Handlung, denn diese wurde dort durch die gleich Naturmächten
wirkenden Charaktere so bestimmt, wie hier durch die in diesen Charakteren
wirkenden, im innersten Wesen identischen Motive des Musikers. Nur da in jener
Sphäre jene, in dieser Sphäre diese Gesetze der Ausdehnung und Bewegung walten.
Wenn wir die Musik die Offenbarung des innersten Traumbildes vom Wesen
der Welt nannten, so dürfte uns Shakespeare als der im Wachen fortträumende
Beethoven gelten. Was ihre beiden Sphären auseinander hält, sind die formellen
Bedingungen der in ihnen gültigen Gesetze der Apperzeption. Die vollendetste
Kunstform müßte demnach von dem Grenzpunkte aus sich bilden, auf welchem jene
Gesetze sich zu berühren vermöchten. Was nun Shakespeare so unbegreiflich wie
unvergleichlich macht, ist, daß die Formen des Dramas, welche noch die
Schauspiele des großen Calderon bis zur konventionellen Sprödigkeit als recht
eigentliche Künstlerwerke bestimmten, von ihm so lebensvoll durchdrungen
wurden, daß sie uns wie von der Natur völlig hinweggedrängt erscheinen: wir
glauben nicht mehr künstlich gebildete, sondern wirkliche Menschen vor uns zu
sehen, wogegen sie wiederum uns so wunderbar fern abstehen, daß wir eine reale
Berührung mit ihnen für so unmöglich halten müssen, als wenn wir
Geistererscheinungen vor uns hätten. -- Wenn nun Beethoven gerade auch in
seinem Verhalten zu den formalen Gesetzen seiner Kunst und in der befreienden
Durchdringung derselben Shakespeare ganz gleichsteht, so dürften wir den
angedeuteten Grenz- oder Übergangspunkt der beiden bezeichneten Sphären am
deutlichsten zu bezeichnen hoffen, wenn wir noch einmal unseren Philosophen uns
zum unmittelbaren Führer nehmen, und zwar indem wir auf dem Zielpunkt seiner
hypothetischen Traumtheorie, die Erklärung der Geistererscheinungen,
zurückgehen.
Es käme hierbei zunächst nicht auf die metaphysische, sondern auf die
physiologische Erklärung des sogenannten "zweiten Gesichtes" an. Dort
ward das Traumorgan als in dem Teile des Gehirnes fungierend gedacht, welcher
durch Eindrücke des mit seinen inneren Angelegenheiten im tiefen Schlafe
beschäftigten Organismus in analoger Weise angeregt werde, wie der jetzt
vollkommen ruhende, nach außen gewandte, mit den Sinnesorganen unmittelbar
verbundene Teil des Gehirnes durch im Wachen empfangene Eindrücke der äußeren
Welt angeregt wird. Die vermöge dieses inneren Organes konzipierte
Traummiteilung konnte nur durch einen zweiten, dem Erwachen unmittelbar
vorausgehenden Traum überliefert werden, welcher den wahrhaftigen Inhalt des
ersten nur in allegorischer Form vermitteln konnte, weil hier beim
vorbereiteten und endlich vor sich gehenden vollen Erwachen des Gehirnes nach
außen bereits die Formen der Erkenntnis der Erscheinungswelt nach Raum und Zeit
in Anwendung gebracht werden mußten, und somit ein den gemeinen Erfahrungen des
Lebens durchaus verwandtes Bild zu konstruieren war. -- Wir verglichen nun das
Werk des Musikers dem Gesichte der hellsehend gewordenen Somnambule, als das
von ihr erschaute und im erregtesten Zustande des Hellsehens auch nach außen
verkündete unmittelbare Abbild des innersten Wahrtraumes, und fanden den Kanal
zu dieser seiner Mitteilung auf dem Wege der Entstehung und Bildung der
Klangwelt auf. -- Zu diesem, hier analogisch angezogenen physiologischen
Phänomen der somnambulen Hellsichtigkeit halten wir nun das andere des
Geistersehens und verwenden hierbei wiederum die hypothetische Erklärung
Schopenhauers, wonach dieses ein bei wachem Gehirne eintretendes Hellsehen sei,
nämlich es gehe dieses infolge einer Depotenzierung des wachen Gesichtes vor
sich, dessen jetzt umflortes Sehen der inner Drang zu einer Mitteilung an das
dem Wachen unmittelbar nahe Bewußtsein benutze, um ihm die im innersten Wahrtraume
erschienene Gestalt deutlich vor sich zu zeigen. Diese so aus dem Inneren vor
das Auge projizierte Gestalt gehört in keiner Weise der realen Welt der
Erscheinung an, dennoch lebt sie vor dem Geisterseher mit all den Merkmalen
eines wirklichen Wesens. Zu diesem, nur in außerordentlichen und seltenen
Fällen dem inneren Willen gelingenden Projizieren des nur von ihm erschauten
Bildes vor die Augen des wachenden, halten wir nun das Werk Shakespeares, um
diesen selbst uns als den Geisterseher und Geisterbanner zu erklären, der die
Gestalten der Menschen aller Zeiten aus seiner innersten Anschauung sich und
uns so vor das wache Auge zu stellen weiß, daß sie wirklich vor uns zu leben
scheinen.
Sobald wir uns nun dieser Analogie mit ihren vollsten Konsequenzen bemächtigen,
dürfen wir Beethoven, den wir den hellsehenden Somnambulen verglichen, als den
wirkenden Untergrund des geistersehenden Shakespeare bezeichnen: was Beethovens
Melodien hervorbringt, projiziert auch die Shakespeareschen Geistergestalten,
und beide werden sich gemeinschaftlich zu einem und demselben Wesen
durchdringen, wenn wir den Musiker, indem er in die Klangwelt hervortritt,
zugleich in die Lichtwelt eintreten lassen. Dies geschähe analog dem
physiologischen Vorgange, welcher einerseits Grund der Geistersichtigkeit wird,
andererseits die somnambule Hellsichtigkeit hervorbringt, und bei welchem
anzunehmen ist, daß eine innere Anregung das Gehirn in umgekehrter Weise, als
beim Wachen es der äußere Eindruck tut, von innen nach außen durchdringt, wo
sie endlich auf die Sinnesorgane trifft und diese bestimmt, nach außen das zu
gewahren, was als Objekt aus dem Inneren hervorgedrungen ist. Nun bestätigen
wir aber die unleugbare Tatsache, daß beim innigen Anhören einer Musik das
Gesicht in der Weise depotenziert werde, da es die Gegenstände nicht mehr
intensiv wahrnähme: somit wäre dies der durch die innerste Traumwelt angeregte
Zustand, welcher als Depotenzierung des Gesichtes die Erscheinung der
Geistergestalt ermöglichte.
Wir können diese hypothetische Erklärung eines anderweitig
unerklärlichen physiologischen Vorganges von verschiedenen Seiten her für die
Erklärung des uns jetzt vorliegenden künstlerischen Problems anwenden, um zu
dem gleichen Ergebnisse zu gelangen. Die Geistergestalten Shakespeares würden
durch das völlige Wachwerden des inneren Musikorganes zum Ertönen gebracht
werden, oder auch: Beethovens Motive würden das depotenzierte Gesicht zum
deutlichen Gewahren jener Gestalten begeistern, in welchen verkörpert diese
jetzt vor unserem hellsichtig gewordenen Auge sich bewegten. In dem einen wie
dem anderen der an sich wesentlich identischen Fälle müßte die ungeheuere
Kraft, welche hier gegen die Ordnung der Naturgesetze in dem angegebenen Sinne
der Erscheinungsbildung von innen nach außen sich bewegte, aus einer tiefsten
Not sich erzeugen, und es würde diese Not wahrscheinlich dieselbe sein, welche
im gemeinen Lebensvorgange den Angstschrei des aus dem bedrängenden des tiefen
Schlafe plötzlich Erwachenden hervorbringt, nur daß hier, im außerordentlichen,
ungeheueren, das Leben des Genius der Menschheit gestaltenden Falle, die Not
dem Erwachen in einer neuen, durch dieses Erwachen einzig offenzulegenden Welt
hellsten Erkennens und höchster Befähigung zuführt.
Dieses Erwachen aus tiefster Not erleben wir aber bei jenem
werkwürdigen, der gemeinen ästhetischen Kritik so anstößig gebliebenen
Übersprunge der Instrumentalmusik in die Vokalmusik, von dessen Erklärung bei
der Besprechung der neunten Symphonie Beethovens wir zu dieser
weitausgreifenden Untersuchung ausgingen. Was wir hierbei empfinden, ist ein
gewisses Übermaß, eine gewaltsame Nötigung zur Entladung nach außen, durchaus
vergleichbar dem Drange nach Erwachen aus einem tiefbeängstigenden Traume, und
das Bedeutsame für den Kunstgenius der Menschheit ist, daß dieser Drang hier
eine künstlerische Tat hervorrief, durch welche diesem Genius ein neues
Vermögen, die Befähigung zur Erzeugung des höchsten Kunstwerkes zugeführt ist.
Auf dieses Kunstwerk haben wir in dem Sinne zu schließen, das es das vollendeteste
Drama, somit ein weit über das Werk der eigentlichen Dichtkunst
hinausliegendes sein muß. Hierauf dürfen wir schließen, die wir die Identität
des Shakespeareschen und des Beethovenschen Dramas erkannten, von welchem wir
andererseits anzunehmen haben, daß es sich zur "Oper" verhalte wie
ein Shakespearesches Stück zu einem Literaturdrama, und eine Beethovensche
Symphonie zu einer Opernmusik.
Daß Beethoven im Verlauf seiner neunten Symphonie einfach zur förmlichen
Chor-Kantate mit Orchester zurückkehrt, hat uns in der Beurteilung jenes
merkwürdigen Übersprunges aus der Instrumental- in die Vokalmusik nicht zu
beirren, die Bedeutung dieses choralen Teiles der Symphonie haben wir zuvor
ermessen und diese als dem eigensten Felde der Musik angehörig erkannt: in ihm
liegt, außer jener eingänglich behandelten Veredelung der Melodie, nichts
formell Unerhörtes für uns vor, es ist eine Kantate mit Textworten, zu denen
die Musik in kein anderes Verhältnis tritt, als zu jedem anderen Gesangstexte.
Wir wissen, daß nicht die Verse des Textdichters, und wären es die Goethes und
Schillers, die Musik bestimmen können, dies vermag allein das Drama, und
zwar nicht das dramatische Gedicht, sondern das wirklich vor unseren Augen sich
bewegende Drama, als sichtbar gewordenes Gegenbild der Musik, wo dann das Wort
und die Rede einzig der Handlung, nicht aber dem dichterischen Gedanken mehr
angehören.
Nicht also das Werk Beethovens, sondern jene in ihm enthaltene
unerhörte künstlerische Tat des Musikers haben wir hier als den Höhepunkt
der Entfaltung seines Genius festzuhalten, indem wir erklären, daß das ganz von
dieser Tat belebte und gebildete Kunstwerk auch die vollendetste Kunstform
bieten müßte, nämlich diejenige Form, in welcher wie für das Drama so besonders
auch für die Musik jede Konventionalität vollständig aufgehoben sein würde.
Dies wäre dann zugleich auch die einzige, dem in unserem großen Beethoven so
kräftig individualisierten deutschen Geiste durchaus entsprechende, von ihm
erschaffene rein menschliche, und doch ihm original angehörige, neue Kunstform,
welche bis jetzt der neueren Welt, im Vergleiche zur antiken Welt, noch fehlt.
Es wird demjenigen, der sich zu den hier von mir ausgesprochenen
Ansichten im Betreff der Beethovenschen Musik bestimmen lassen sollte, nicht zu
ersparen sein, für phantastisch und überschwenglich gehalten zu werden, und
zwar wird ihm dieser Vorwurf nicht nur von unseren heutigen gebildeten und
ungebildeten Musikern, welche das von uns gemeinte Traumgesicht der Musik
meistens nur unter der Gestalt des Traumes Zettels im Sommernachtstraum
erfahren haben, gemacht werden, sondern namentlich auch von unseren
Literaturpoeten und selbst bildenden Künstlern, insoweit diese sich überhaupt
um fragen, welche ganz von ihrer Sphäre abzuführen scheinen, bekümmern. Leicht
müßten wir uns aber dazu entschließen, jenen Vorwurf, selbst wenn er recht
geringschätzig, ja mit einem auf Beleidigung berechneten Darüberhinwegsehen uns
ausgedrückt würde, ruhig zu ertragen, denn es leuchtet uns ein, daß wir zunächst
jene gar nicht zu ersehen vermögen, war wir erkennen, wogegen sie im besten
Falle genau nur so viel hiervon zu gewahren imstande sind, als nötig sein
dürfte, um ihnen ihre eigenen Unproduktivität erklärlich zu machen: daß sie vor
dieser Erkenntnis aber zurückschrecken, muß wiederum uns nicht unverständlich
sein.
Führen wir uns den Charakter unserer jetzigen literarischen und
künstlerischen Öffentlichkeit vor, so gewahren wir eine merkliche Wandelung,
welche seit etwa einem Menschenalter hierin sich zugetragen hat. Es steht hier
alles nicht nur wie Hoffnung, sondern sogar in einem solchen Grade wie
Gewißheit aus, daß die große Periode der deutschen Wiedergeburt, mit ihren
Goethe und Schiller, selbst mit einer, immerhin wohltemperierten,
Geringschätzung angesehen wird. Dies war vor einem Menschenalter ziemlich
anders: es gab sich damals der Charakter unseres Zeitalters unverhohlen für
einen wesentlich kritischen aus, man bezeichnete den Zeitgeist als einen
"papierenen" und glaubte selbst der bildenden Kunst nur noch in der
Zusammenstellung und Verwendung überkommener Typen eine allerdings von jeder
Originalität entkleidete, lediglich reproduzierende Wirksamkeit zusprechen zu
dürfen. Wir müssen annehmen, daß man hierin um jene Zeit wahrhaftiger sah und
ehrlicher sich aussprach, als dies heutzutage der Fall ist. Wer daher noch
jetzt, trotz des zuversichtlichen Gebarens unserer Literaten und literarischen
Bildner, Erbauer und sonstiger mit dem öffentlichen Geiste verkehrenden
Künstler, der Meinung von damals sein sollte, mit dem dürften wir uns leichter
zu verständigen hoffen, wenn wir die unvergleichliche Bedeutung, welche die
Musik für unsere Kulturentwickelung gewonnen hat, in ihr rechtes Licht zu
stellen unternehmen, wofür wir uns schließlich aus dem vorzüglichen Versenken
in die innere Welt, wie sie unsere bisherige Untersuchung veranlaßte, einer
Betrachtung der äußeren Welt zuwenden, in welcher wir leben und unter deren
Drucke jenes innere Wesen zu der ihm jetzt eigenen, nach außen reagierenden
Kraft sich ermächtigte.
Um uns hierbei nicht etwa in einem weit gesponnenen
kulturgeschichtlichen Irrgewebe zu verfangen, halten wir sofort einen
charakteristischen Zug des öffentlichen Geistes der unmittelbaren Gegenwart
fest.--
Während die deutschen Waffen siegreich nach dem Zentrum der
französischen Zivilisation vordringen, regt sich bei uns plötzlich das
Schamgefühl über unsere Abhängigkeit von dieser Zivilisation und tritt als
Aufforderung zur Ablegung der Pariser Modetrachten vor die Öffentlichkeit. Dem
patriotischen Gefühle erscheint also endlich das anstößig, was der ästhetische
Schicklichkeitssin der Nation so lange nicht nur ohne jede Protestation
ertragen, sondern dem unser öffentlicher Geist sogar mit Hast und Eifer
nachgestrebt hat. Was sagte in der Tat wohl dem Bildner ein Blick auf unsere
Öffentlichkeit, welche einerseits nur Stoff zu den Karikaturen unserer
Witzblätter darbot, während andererseits wiederum unsere Poeten ungestört
fortfuhren, das "deutsche Weib" zu beglückwünschen? -- Wir meinen, über
diese so eigentümlich komplizierte Erscheinung sei wohl kein Wort der
Beleuchtung zu verlieren. -- Vielleicht könnte sie aber als ein vorübergehendes
Übel angesehen werden: man könnte erwarten, das Blut unserer Söhne, Brüder und
Gatten, für den erhabensten Gedanken des deutschen Geistes auf den
mörderischsten Schlachtfeldern der Geschichte vergossen, müßte unseren
Töchtern, Schwestern und Frauen wenigstens die Wange mit Scham röten, und
plötzlich müßte eine edelste Not ihnen den Stolz erwecken, ihren Männern nicht
mehr als Karikaturen der lächerlichsten Art sich vorzustellen. Zur Ehre der
deutschen Frauen wollen wir nun auch gern glauben, daß ein würdiges Gefühl in
diesem Betreff sie bewege, und dennoch mute wohl jeder lächeln, wenn er von den
ersten an sie gerichteten Aufforderungen, sich eine neue Tracht zuzulegen,
Kenntnis nahm. Wer fühlte nicht, daß hier nur vor einer neuen und vermutlich
sehr ungeschickten Maskerade die Rede sein konnte? Denn es ist nicht eine
zufällige Laune unseres öffentlichen deutschen Lebens, daß wir unser der
Herrschaft der Mode stehen, ebenso wie es in der Geschichte der modernen
Zivilisation sehr wohl begründet ist, daß die Launen des Pariser Geschmackes
uns die Gesetze der Mode diktieren. Wirklich ist der französische Geschmack,
d.h. der Geist von Paris und Versailles, seit zweihundert Jahren das einzige
produktive Ferment der europäischen Bildung gewesen, während der Geist keiner
Nation mehr Kunsttypen zu bilden vermochte, produzierte der französische Geist
wenigstens noch die äußere Form der Gesellschaft, und bis auf den heutigen Tag
die Modetracht.
Mögen diese nun unwürdige Erscheinungen sein, so sind sie doch dem
französischen Geiste original entsprechend, sie drücken ihn ganz so bestimmt
und schnell erkenntlich aus, wie die Italiener der Renaissance, die Römer, die
Griechen, die Ägypter und Assyrer in ihren Kunsttypen sich ausgedrückt haben,
und durch nichts bezeigen uns die Franzosen mehr, daß sie das herrschende Volk
der heutigen Zivilisation sind, als dadurch, daß unsere Phantasie sogleich auf
das Lächerliche gerät, wenn wir uns imaginieren, uns bloß von ihrer Mode
emanzipieren zu wollen. Wir erkennen sogleich, daß eine der französischen Mode
gegenübergestellte "deutsche Mode" etwas ganz Absurdes sein würde,
und müssen, da sich doch wieder unser Gefühl gegen jene Herrschaft empört,
schließlich einsehen, daß wir einem wahren Fluche verfallen sind, von welchem
uns nur eine unendlich tief begründete Neugeburt erlösen könnte. Unser ganzes
Grundwesen müßte sich nämlich derart ändern, da der Begriff der Mode
selbst für die Gestaltung unseres äußeren Lebens gänzlich sinnlos zu werden
hätte.
Darauf, worin diese Neugeburt bestehen müßte, hätten wir nun mit großer
Vorsicht Schlüsse zu ziehen, wenn wir zuerst den Gründen des tiefen Verfalles
des öffentlichen Kunstgeschmackes nachgeforscht. Da uns die Anwendung von
Analogien schon für den Hauptgegenstand unserer Untersuchungen mit einigem
Glücke zu sonst schwierig zu erlangenden Aufschlüssen leitete, versuchen wir
nochmals, uns zunächst auf ein anscheinend abliegendes Gebiet der Betrachtung
zu begeben, auf welchem wir aber jedenfalls eine Ergänzung unserer Ansichten
über den plastischen Charakter unserer Öffentlichkeit gewinnen dürften. --
Wollen wir uns ein wahres Paradies von Produktivität des menschlichen
Geistes vorstellen, so haben wir uns in die Zeiten vor der Erfindung der Schrift
und ihrer Aufzeichnung auf Pergament oder Papier zu versetzen. Wir müssen
finden, daß hier das ganze Kulturleben geboren worden ist, welches jetzt nur
noch als Gegenstand des Nachsinnens oder der zweckmäßigen Anwendung sich
forterhält. Hier war denn auch die Poesie nichts anderes als wirkliche
Erfindung von Mythen, d.h. von idealen Vorgängen, in welchen sich das
menschliche Leben nach seinem verschiedenen Charakter mit objektiver
Wirklichkeit, im Sinne von unmittelbaren Geistererscheinungen, abspiegelte. Die
Befähigung hierzu sehen wir jedem edelgearteten Volke zu eigen, bis zu dem
Zeitpunkte, wo der Gebrauch der Schrift zu ihm gelangt. Von da ab schwindet ihm
die poetische Kraft, die bisher wie im steten Naturentwickelungsprozeß lebendig
sich gestaltende Sprache verfällt in den Kristallisationsprozeß und erstarrt,
die Dichtkunst wird zur Kunst der Ausschmückung der alten, nun nicht mehr
neuzuerfindenden Mythen und endigt als Rhetorik und Dialektik. -- Nun aber
vergegenwärtigen wir uns den Übersprung der Schrift zur Buchdruckerkunst. Aus
dem kostbaren geschriebenen Buche las der Hausherr der Familie, den Gästen vor,
nun jedoch liest jeder selbst aus dem gedruckten Buche still für sich, und für
die Leser schreibt jetzt der Schriftsteller. Man muß die religiösen Sekten der
Reformationszeit, ihre Disputate und Traktätlein sich zurückrufen, um einen
Einblick in das Wüten des Wahnsinns zu gewinnen, welcher sich der vom Buchstaben
besessenen Menschenköpfe bemächtigt hatte. Man kann annehmen, daß nur Luthers
herrlicher Choral den gesunden Geist der Reformation rettete, weil er das Gemüt
bestimmte und die Buchstaben-Krankheit der Gehirne damit heilte. Aber noch
konnte der Genius eines Volkes mit dem Buchdrucker sich verständigen, so
kläglich im der Verkehr auch ankommen mochte, mit der Erfindung der Zeitungen,
seit dem vollen Aufblühen des Journalwesens, mußte jedoch dieser gute Geist des
Volkes sich gänzlich aus dem Leben zurückziehen. Denn jetzt herrschen nur noch
Meinungen, und zwar "öffentliche", diese sind für Geld zu haben wie
die öffentlichen Dirnen: wer eine Zeitung sich hält, hat neben der Makulatur
noch ihre Meinung sich angeschafft, er braucht nicht mehr zu denken, noch zu
sinnen, schwarz auf weiß ist bereits für ihn gedacht, was von Gott und der Welt
zu halten sei. So sagt denn auch das Pariser Modejournal dem "deutschen
Weibe", wie es sich zu kleiden hat, denn in solchen Dingen uns das
Richtige sagen zu dürfen, dazu hat der Franzose sich ein volles Recht erworben,
da er sich zum eigentlichen farbigen Illustrator unserer Journal-Papier-Welt
aufgeschwungen hat.
Halten wir zu der Umwandlung der poetischen Welt in eine
journalliteraische Welt jetzt diejenige, welche die Welt als Form und Farbe
erfahren hat, so treffen wir nämlich auf das ganz gleiche Ergebnis.
Wer wäre so anmaßend, von sich sagen zu wollen, daß er sich wirklich
einen Begriff von der Größe und göttlichen Erhabenheit der plastischen Welt des
griechischen Altertums zu machen vermöge? Jeder Blick auf ein einziges
Bruchstück ihrer uns erhaltenen Trümmer läßt uns mit Schauer empfinden, daß wir
hier vor einem Leben stehen, zu dessen Beurteilung wir auch noch nicht einmal
den mindesten Maßansatz finden können. Jene Welt hatte sich das Vorrecht
erworben, selbst aus ihren Trümmern für alle Zeiten uns darüber zu belehren,
wie der übrige Verlauf des Weltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten wäre.
Wir danken es den großen Italienern, diese Lehre uns neu belebt und edelsinnig
in unsere Welt hinübergeleitet zu haben. Dieses mit so reicher Phantasie
hochbegabte Volk sehen wir in der leidenschaftlichen Pflege jener Lehre sich
völlig verzehren, nach einem wundervollen Jahrhunderte tritt es wie ein Traum
aus der Geschichte, welche von nun an eines verwandt erscheinenden Volkes
irrtümlich sich bemächtigt, wie um zu sehen, was aus diesem etwa für Form und
Farbe der Welt zu ziehen sein möchte. Die italienische Kunst und Bildung suchte
ein kluger Staatsmann und Kirchenfürst dem französischen Volksgeiste
einzuimpfen, nachdem diesem Volke der protestantische Geist vollständig
ausgetilgt war: seine edelsten Häupter hatte es fallen sehen, und was die
Pariser Bluthochzeit verschont, war endlich noch sorgsam bis auf den letzten
Stumpf ausgebrannt worden. Mit dem Reste der Nation ward nun
"künstlerisch" verfahren, da ihr aber jede Phantasie abging oder
ausgegangen war, wollte sich die Produktivität nirgends zeigen, und namentlich
blieb sie unfähig+, eben ein Werk der Kunst zu schaffen. Besser gelang es, den
Franzosen selbst zu einem künstlichen Menschen zu machen, die künstlerische
Vorstellung, die seiner Phantasie nicht einging, konnte zu einer künstlichen
Darstellung des ganzen Menschen an sich selbst gemacht werden. Dies konnte sogar
für antik gelten, nämlich wenn man annahm, daß der Mensch an sich selbst erst
Künstler sein müsse, ehe er Kunstwerke hervorzubringen hätte. Ging nun ein
angebeteter galanter König mit dem rechten Beispiele einer ungemein delikaten
Haltung in allem und jedem voran, so war es leicht, auf der von ihm
absteigenden Klimax durch die Hofherren hinab endlich das ganze Volk zur
Annahme der galanten Manieren zu bestimmen, in deren zur zweiten Natur artenden
Pflege der Franzose sich insofern endlich über den Italiener der Renaissance
erhaben dünken mochte, als dieser nur Kunstwerke geschaffen, der Franzose
dagegen selbst ein Kunstwerk geworden sei.
Man kann sagen, der Franzose ist das Produkt einer besonderen Kunst,
sich auszudrücken, sich zu bewegen und zu kleiden. Sein Gesetz hierfür ist der
"Geschmack" -- ein Wort, das von der niedrigsten Sinnesfunktion her
auf eine geistige Tendenz hingeleitet worden ist, und mit diesem Geschmacke
schmeckt er sich eben selbst, nämlich so, wie er sich zubereitet hat, als eine
schmackhafte Sauce. Unstreitig hat er es hierin zur Virtuosität gebracht: er
ist durch und durch "modern", und wenn er der ganzen zivilisierten
Welt sich so zur Nachahmung vorstellt, ist es nicht sein Fehler, wenn er
ungeschickt nachgeahmt wird, wogegen es ihm vielmehr zur steten Schmeichelei
gereicht, daß nur er in dem original ist, worin andere ihm nachzuahmen sich
bestimmt fühlen. -- Dieser Mensch ist denn auch völlig "Journal", ihm
ist die bildende Kunst, wie nicht minder die Musik, ein Objekt des
"Feuilleton". Die erstere hat er sich, als durchaus moderner Mensch,
so zurechtgelegt wie seine Kleidertracht in welcher er rein nach dem Belieben
der Neuheit, d.h. des stets bewegten Wechsels verfährt. Hier ist das
Ameublement die Hauptsache, zu diesem konstruiert der Architekt das Gehäuse.
Die Tendenz, nach welcher dieses früher geschah, war bis zur großen Revolution
noch in dem Sinne original, daß sie dem Charakter der herrschenden Klasse der
Gesellschaft sich in der Weise anschmiegte, wie die Kleidertracht den Leibern
und die Frisur den Köpfen derselben. Seitdem ist diese Tendenz insofern in
Verfall geraten, als die vornehmeren Klassen sich schüchtern des Tonangebens in
der Mode enthalten und dagegen die Initiative hierfür den zur Bedeutung
gelangten breiteren Schichten der Bevölkerung (wir fassen immer Paris in das
Auge) überlassen haben. Hier ist denn nun der sogenannte "Demimonde"
mit seinen Liebhabern zum Tonangeber geworden: die Pariser Dame sucht sich
ihrem Gatten durch Nachahmung der Sitten und Trachten desselben anziehend zu
machen: denn hier ist andererseits doch alles noch so original, daß Sitten und
Trachten zueinander gehren und sich ergänzen. Von dieser Zeit wird nun auf
jeden Einfluß auf die bildende Kunst verzichtet, welche endlich gänzlich in die
Domäne der Kunstmodehändler, als Quincaillerie und Tapezierarbeit -- fast wie
in den ersten Anfängen der Künste bei nomadischen Völkern -- übergegangen ist.
Der Mode stellt sich bei dem steten Bedürfnisse nach Neuheit, da sie selbst nie
etwas wirklich Neues produzieren kann, der Wechsel der Extreme als einzige
Auskunft zu Gebote: wirklich ist es diese Tendenz, an welche unsere sonderbar
beratenen bildenden Künstler endlich anknüpfen, um auch edle, natürlich nicht
von ihnen erfundene Formen der Kunst wieder zum Vorschein zu bringen. Jetzt
wechseln Antike und Rokoko, Gotik und Renaissance unter sich ab, die Fabriken
liefern Laokoongruppen, chinesisches Porzellan, kopierte Raffaele und Murillos,
hetrurische Vasen, mittelalterliche Teppichgewebe, dazu Meubles a la Pompadour,
Stukkaturen a la Louis XIV., der Architekt schließt das Ganze in
Florentinischen Stil ein und stellt eine Ariadnegruppe darauf.
Nun wird die "moderne" Kunst ein neues Prinzip auch für den
Ästhetiker: das Originelle derselben ist ihre gänzliche Originalitätslosigkeit,
und ihr unermeßlicher Gewinn besteht in dem Umsatz aller Kunststile, welche nun
der gemeinsten Wahrnehmung kenntlich und nach beliebigem Geschmack für jeden
verwendbar geworden sind. -- Aber auch ein neues Humanitätsprinzip wird ihr zuerkannt,
nämlich die Demokratisierung des Kunstgeschmackes. Es heißt da: man solle aus
dieser Erscheinung für die Volksbildung Hoffnung schöpfen, denn nun seien die
Kunst und ihre Erzeugnisse nicht mehr bloß für den Genuß der bevorzugten
Klassen vorhanden, sondern der geringste Bürger habe jetzt Gelegenheit, die
edelsten Typen der Kunst sich auf seinem Kamine vor die Augen zu stellen, was
selbst dem Bettler am Schaufenster der Kunstläden noch möglich falle.
Jedenfalls solle man damit zufrieden sein, denn wie, da nun einmal alles
untereinander vor uns daliege, selbst dem begabtesten Kopfe noch die Erfindung
eines neuen Kunststiles für Bildnerei wie für Literatur ankommen könnte, das
müsse doch geradezu unbegreiflich bleiben. --
Wir dürfen diesem Urteile nun vollkommen beistimmen, denn es liegt hier
ein Ergebnis der Geschichte von derselben Konsequenz, wie das unserer
Zivilisation überhaupt, vor. Es wäre denkbar, da diese Konsequenzen sich
abstumpften, nämlich im Untergange unserer Zivilisation, was ungefähr anzunehmen
wäre, wenn alle Geschichte über den Haufen geworfen würde, wie dies etwa in den
Konsequenzen des sozialen Kommunismus liegen müßte, wenn dieser sich der modernen Welt im Sinne einer
praktischen Religion bemächtigen sollte. Jedenfalls stehen wir mit unserer
Zivilisation am Ende aller wahren Produktivität im Betreff der plastischen Form
derselben und tun schließlich wohl, uns daran zu gewöhnen, auf diesem Gebiete,
auf welchem die antike Welt uns als unerreichbares Vorbild dasteht, nichts
diesem Vorbilde Ähnliches mehr zu erwarten, dagegen wir uns mit diesem
sonderbaren, manchem ja sogar sehr anerkennungswert dünkenden Ergebnisse der
modernen Zivilisation vielleicht zu begnügen haben, und zwar mit demselben
Bewußtsein, mit welchem wir jetzt die Ausstellung einer neuen deutschen
Kleidermode für uns, und namentlich unsere Frauen, als einen vergeblichen
Reaktionsversuch gegen den Geist unserer Zivilisation erkennen müssen.
Denn soweit unser Auge streift, beherrscht uns die Mode. --
Aber neben dieser Welt der Mode ist uns eben gleichzeitig eine andere Welt
erstanden. Wie unter der römischen Universalzivilisation das Christentum
hervortrat, so bricht jetzt aus dem Chaos der modernen Zivilisation die Musik
hervor. Beide sagen aus: "Unser Reich ist nicht von dieser Welt." Das
heißt eben: wir kommen von innen, ihr von außen, wir entstammen dem Wesen, ihr
dem Schein der Dinge.
Erfahre jeder an sich, wie die ganze moderne Erscheinungswelt, welche
ihn überall zu seiner Verzweiflung undurchbrechbar einschließt, plötzlich in
nichts vor ihm verschwindet, sobald ihm nur die ersten Takte einer jener
göttlichen Symphonien ertönen. Wie wäre es möglich, in einem heutigen
Konzertsaale (in welchem Turkos und Zuaven sich allerdings behaglich fühlen würden!)
nur mit einiger Andacht dieser Musik zu lauschen, wenn unserer optischen
Wahrnehmung, wie wir dieses Phänomen schon oben berührten, die sichtbare
Umgebung nicht verschwände? Dies ist nun aber, im ernstesten Sinne aufgefaßt,
die gleiche Wirkung der Musik unserer ganzen modernen Zivilisation gegenüber,
die Musik hebt sie auf, wie das Tageslicht den Lampenschein. --
Es ist schwer, sich deutlich vorzustellen, in welcher Art die Musik von
je ihre besondere Macht der Erscheinungswelt gegenüber äußerte. Uns muß es
dünken, daß die Musik der Hellenen die Welt der Erscheinung selbst innig
durchdrang und mit den Gesetzen ihrer Wahrnehmbarkeit sich verschmolz. Die
Zahlen des Pythagoras sind gewiß nur aus der Musik lebendig zu verstehen, nach
den Gesetzen der Eurythmie baute der Architekt, nach denen der Harmonie erfaßte
der Bildner die menschliche Gestalt, die Regeln der Melodik machten den Dichter
zum Sänger, und aus dem Chorgesange projizierte sich das Drama auf die Bühne.
Wir sehen überall das innere, nur aus dem Geiste der Musik zu verstehende
Gesetz das äußere, die Welt der Anschaulichkeit ordnende Gesetz bestimmen: den
echt antiken dorischen Staat, welchen Platon aus der Philosophie für den
Begriff festzuhalten versuchte, ja die Kriegsordnung, die Schlacht, leiteten
die Gesetze der Musik mit der gleichen Sicherheit wie den Tanz. -- Aber das
Paradies ging verloren: der Urquell der Bewegung einer Welt versiegte. Diese
bewegte sich, wie die Kugel auf den erhaltenen Stoß, im Wirbel der
Radienschwingung, doch in ihr bewegte sich keine treibende Seele mehr, und so
mute auch die Bewegung endlich erlahmen, bis die Weltseele neu wieder erweckt
wurde.
Der Geist des Christentums war es, der die Seele der Musik neu wieder
belebte. Sie verklärte das Auge des italienischen Malers und begeisterte seine
Sehkraft, den in der Kirche andererseits verkommenden Geist des Christentums zu
dringen. Diese großen Maler waren fast alle Musiker, und der Geist der Musik
ist es, der und beim Versenken in den Anblick ihrer Heiligen und Märtyrer
vergessen läßt, daß wir hier sehen. -- Doch es kam die Herrschaft der
Mode; wie der Geist der Kirche der künstlichen Zucht der Jesuiten verfiel, so
ward mit der Bildnerei auch die Musik zur seelenlosen Künstelei. Wir verfolgten
nun an unserem großen Beethoven den wundervollen Prozeß der Emanzipation all
des Materiales, welches herrliche Vorgänger mühevoll dem Einflusse dieser Mode
entzogen hatten, der Melodie ihren ewig gültigen Typus, der Musik selbst ihre
unsterbliche Seele wiedergegeben habe. Mit der nur ihm eigenen göttlichen
Naivität drückt unser Meister seinem Siege auch den Stempel des vollen
Bewußtseins, mit welchem er ihn errungen, auf. In dem Gedichte Schillers,
welches er seinem wunderbaren Schlußsatze der neunten Symphonie unterlegt,
erkannte er vor allem die Freude der von der Herrschaft der "Mode"
befreiten Natur. Betrachten wir die merkwürdige Auffassung, welche er den
Worten des Dichters:
"Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt"
gibt. Wie wir dies bereits fanden, legte Beethoven die Worte der Melodie
eben nur als Gesangstext in dem Sinne eines allgemeinen Zusammenstimmens des
Charakters der Dichtung mit dem Geiste dieser Melodie unter. Das, was man unter
richtiger Deklamation, namentlich im dramatischen Sinne, zu verstehen pflegt,
läßt er hierbei fast gänzlich unbeachtet: so läßt er auch jenen Vers "was
die Mode streng geteilt" bei der Absingung der ersten drei Strophen des
Gedichtes ohne jede besondere Hervorhebung der Worte an uns vorübergehen. Dann
aber, nach unerhörter Steigerung der dithyrambischen Begeisterung, faßt er
endlich auch die Worte dieses Verses mit vollem dramatischen Affekte auf, und
als er sie in einem fast wütend drohenden Unisono wiederholen läßt, ist ihm das
Wort "streng" für seinen zürnenden Ausdruck nicht genügend.
Merkwürdig, da dieses maßvollere Epitheton für die Aktion der Mode sich auch
nur einer späteren Abschwächung von seiten des Dichters verdankt, welcher in
der ersten Ausgabe seines Liedes an die Freude noch hatte drucken lassen:
"Was der Mode Schwert geteilt!"
dieses "Schwert" schien nun Beethoven wieder nicht das
Richtige zu sagen, es kam ihm, der Mode zugeteilt, zu edel und heroisch vor. So
setzte er denn aus eigener Machtvollkommenheit "frech" hin,
und nun singen wir:
"Was die Mode frech geteilt" --
(*In der übrigens so verdankenswerten Härtelschen
Gesamtausgabe der Beethovenschen werke ist von einem Mitgliede des an einem
anderen Orte von mir charakterisierten musikalischen
"Mäßigkeitsvereines", welches die "Kritik" dieser Ausgabe
besorgte, auf S. 260 u.f. der Partitur der neunten Symphonie dieser so
sprechende Zug vertilgt und für das "frech" der Schottschen
Originalausgabe das wohlanständige, sittig-mäßige "streng"
eigenmächtig hingestellt worden. Ein Zufall entdeckte mir soeben diese Fälschung,
die, wenn wir über ihre Motive nachdenken, wohl geeignet ist, uns mit
schauerlichen Ahnungen über das Schicksal der Werke unseres großen Beethoven zu
erfüllen, wenn wir sie für alle Zeiten einer in diesem Sinne progressiv sich
ausbildenden Kritik verfallen sehen müßten. --)
Kann etwas sprechender sein, als dieser merkwürdige, bis zur
Leidenschaftlichkeit heftige künstlerische Vorgang? Wir glauben Luther in
seinem Zorne gegen den Papst vor uns zu sehen! --
Gewiß darf es uns erscheinen, daß unsere Zivilisation, soweit sie
namentlich auch den künstlerischen Menschen bestimmt, nur aus dem Geiste
unserer Musik, der Musik, welche Beethoven aus den Banden der Mode befreite,
neu beseelt werden könne. Und die Aufgabe, in diesem Sinne der vielleicht
hierdurch sich gestaltenden neuen, seelenvolleren Zivilisation die sie
durchdringende neue Religion zuzuführen, kann ersichtlich nur dem deutschen
Geiste beschieden sein, den wir selbst erst richtig verstehen lernen, wenn wir
jede ihm zugeschriebene falsche Tendenz fahren lassen.
Wie schwer nun aber die richtige Selbsterkenntnis namentlich für eine
ganze Nation ist, erfahren wir jetzt zu unserem wahren Schrecken an unserem
bisher so mächtigen Nachbarvolke der Franzosen, und wir mögen daraus eine
ernste Veranlassung zur eigenen Selbsterforschung nehmen, wofür wir uns
glücklicherweise nur den ernsten Bemühungen unserer großen deutschen Dichter
anzuschließen haben, deren Grundstreben, bewußt wie unbewußt, diese
Selbsterforschung war.
Es mußte diesen fraglich dünken, wie das so unbeholfen und scherfällig
sich gestaltende deutsche Wesen neben der so sicher und leicht bewegten Form
unserer Nachbarn romanischer Herkunft einigermaßen vorteilhaft sich behaupten
sollte. Da andererseits dem deutschen Geiste ein unleugbarer Vorzug in der ihm
eigenen Tiefe und Innigkeit des Erfassens der Welt und ihrer Erscheinungen
zuzuerkennen war, frug es sich immer, wie dieser Vorzug zu einer glücklichen
Ausbildung des Nationalcharakters, und von hier aus zu einem günstigen
Einflusse auf den Geist und den Charakter der Nachbarvölker anzuleiten wäre,
während bisher, sehr ersichtlicherweise, Beeinflussungen dieser Art mehr
schädlich als vorteilhaft von dorther auf uns gewirkt hatten.
Verstehen wir nun die beiden durch das Leben unseres größten Dichters
gleich Hauptadern sich durchziehenden poetischen Grundentwürfe richtig, so
erhalten wir hieraus die vorzüglichste Anleitung zur Beurteilung des Problems,
welches sofort beim Antritt seiner unvergleichlichen Dichterlaufbahn diesem
freiesten deutschen Menschen sich darstellte. --
Wir wissen, daß die Konzeption des "faust" und des
"Wilhelm Meister" ganz in die gleiche Zeit des ersten übervollen
Erblühens des Goetheschen Dichtergenius fällt. Die tiefe Inbrunst des in
erfüllenden Gedankens drängte ihn zunächst zu der Ausführung der ersten Anfänge
des "Faust": wie vor dem Übermaße der eigenen Konzeption erschreckt,
wendete er sich von dem gewaltigen Vorhaben zu der beruhigenderen Form der
Auffassung des Problems im "Wilhelm Meister". In der Reife des
Mannesalters führte er diesen leicht fließenden Roman auch aus. Sein Held ist
der sichere und gefällige Form sich suchende deutsche Bürgersohn, der über das
Theater hinweg, durch die adelige Gesellschaft dahin, einem nützlichen
Weltbürgertume zugeführt wird, ihm ist ein Genius beigegeben, den er nur
oberflächlich versteht, ungefähr so, wie Goethe damals die Musik verstand, wird
von Wilhelm Meister "Mignon" erkannt. Der Dichter läßt unsere
Empfindung es deutlich innewerden, daß an "Mignon" ein empörendes
Verbrechen begangen wird, seinen Helden jedoch geleitet er über die gleiche
Empfindung hinweg, um ihn in einer von aller Heftigkeit und tragischen
Exzentrizität befreiten Sphäre einer schönen Bildung zugeführt zu wissen. Er
läßt ihn in einer Galerie sich Bilder besehen. Zu Mignons Tode wird Musik
gemacht, und Robert Schumann hat diese später wirklich komponiert. -- Es
scheint, daß Schiller von dem letzten Buche des "Wilhelm Meister"
empört war, doch wußte er wohl dem großen Freunde aus seiner seltsamen Verirrung
nicht zu helfen, besonders da er anzunehmen hatte, Goethe, der eben doch Mignon
gedichtet und uns eine wunderbar neue Welt mit dieser Schöpfung in das Leben
gerufen hatte, müßte in seinem tiefsten Inneren einer Zerstreuung verfallen
sein, aus welcher es dem Freunde nicht gegeben war, ihn zu erwecken. Nur Goethe
selbst konnte sich aus ihr erwecken, -- und er erwachte; denn im höchsten Alter
vollendete er seinen "Faust". Was ihn je zerstreute, faßt er hier in
ein Urbild aller Schönheit zusammen: Helena selbst, das ganze, volle
antike Ideal beschwörte er aus dem Schattenreich herauf und vermählt sie seinem
Faust. Aber der Schatten ist nicht festzubannen, er verflüchtigt sich zum
davonschwebenden schönen Gewölk, dem Faust in sinniger, doch schmerzloser
Wehmut nachblickt. Nur Gretchen konnte ihn erlösen: aus der Welt der
Seligen reicht die früh Geopferte, unbeachtet in seinem tiefsten Inneren ewig
innig Fortlebende, ihm die Hand. Und dürfen wir, wie wir im Laufe unserer
Untersuchung die analogischen Gleichnisse aus der Philosophie und Physiologie
herangezogen, jetzt auch dem tiefsten Dichterwerke eine Deutung für uns zu
geben versuchen, so verstehen wir unter dem: "Alles Vergängliche ist nur
ein Gleichnis" -- den Geist der bildenden Kunst, der Goethe so lange und
vorzüglich nachstrebte, unter dem: "Das ewig Weibliche zieht uns
hinan" aber den Geist der Musik, der aus des Dichters tiefstem Bewußtsein
sich emporschwang, nun über ihm schwebt uns ihn den Weg der Erlösung geleitet.
--
Und diesen Weg aus tiefinnerstem Erlebnis hat der deutsche Geist sein
Volk zu führen, wenn er die Völker beglücken soll, wie er berufen ist.
Verspotte uns, wer will, wenn wir diese unermeßliche Bedeutung der deutschen
Musik beilegen, wir lassen uns dadurch so wenig irremachen, als das deutsche Volk
sich beirren ließ, da seine Feinde auf einen wohl berechneten Zweifel an seiner
einmütigen Tüchtigkeit hin es beleidigen zu dürfen vermeinten. Auch dies wußte
unser großer Dichter, als er nach einer Tröstung dafür suchte, daß ihm die
Deutschen so läppisch und nichtig in ihren aus schlechter Nachahmung
entsprungenen Manieren und Gebarungen erscheint, sie heißt: "Der
Deutsche ist tapfer." Und das ist etwas!--
Sei das deutsche Volk nun auch tapfer im Frieden, hege es seinen wahren
Wert und werfe es den falschen Schein von sich: möge es nie für etwas gelten
wollen, was es nicht ist, und dagegen das in sich erkennen, worin es einzig
ist. Ihm ist das Gefällige versagt, dafür ist sein wahrhaftes Dichten und Tun
innig und erhaben. Und nichts kann sich den Siegen seiner Tapferkeit in diesem
wundervollen Jahre 1870 erhebender zur Seite stellen, als das Andenken an
unseren großen Beethoven, der nun vor hundert Jahren dem deutschen Volke
geboren wurde. Dort, wo hin jetzt unsere Waffen dringen, an dem Ursitze der
"frechen Mode" hatte sein Genius schon die edelste Eroberung
begonnen: was dort unsere Denker, unsere Dichter, nur mühsam übertragen,
unklar, wie mit unverständlichem Laute berührten, das hatte die Beethovensche
Symphonie schon im tiefsten Inneren erregt: die neue Religion, die
welterlösende Verkündigung der erhabensten Unschuld war dort schon verstanden,
wie bei uns.
So feiern wir denn den großen Bahnbrecher in der Wildnis des entarteten
Paradieses! Aber feiern wir ihn würdig, -- nicht minder würdig als die Siege
deutscher Tapferkeit: denn dem Weltbeglücker gehört der Rang noch vor dem
Welteroberer!